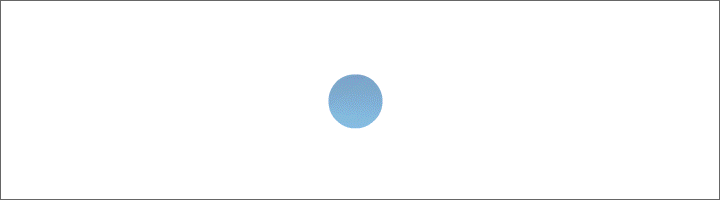Adelheids Reisen ans Meer
Im Lebenslauf der Schriftstellerin Adelheid Duvanel (1936-1996), die ihre Kindheit und Jugend in Pratteln und Liestal verbracht hat, erscheint deren Aufenthalt auf Formentera 1968/69 als Intermezzo. Aber das Leben auf der spanischen Mittelmeerinsel beeinflusste die Existenz und das Schreiben der schwierigen Autorin, die 1987 den Basler Literaturpreis erhielt, nachhaltig.
Von Felix Feigenwinter
In seinem Buch "Die tintenblauen Eidgenossen" (2001, Carl Hanser Verlag München Wien) hisst der Literaturwissenschaftler Peter von Matt Adelheid Duvanel postum sozusagen auf den Olymp der Schweizer Literatur, stellt sie - übrigens als einzige Frau - in die Reihe von Gotthelf, Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, Friedrich Glauser, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Gerhard Meier, Hugo Loetscher, Peter Bichsel, Jürg Laederach, Urs Widmer und Thomas Hürlimann. Nun wurde die Schreibkunst dieser Erzählerin während ihres schwierigen Lebens zwar immer wieder mit Preisen im In- und Ausland gewürdigt, angefangen vom Kranichstener Literaturpreis 1984 über den Basler Literaturpreis 1987 bis zum Literaturpreis des Kantons Bern 1995. Doch die Autorin, diese "Chronistin der Ausgegrenzten", wie sie auch schon genannt wurde, blieb bis zu ihrem Suizid im Juli 1996 selber eine Aussenseiterin, um nicht zu sagen Ausgestossene - als Mutter einer drogenabhängigen, aidskranken Tochter, deren sozial randständiges Leben sie in den letzten Jahren ihres Daseins gewissermassen teilte. Ein schmerzlicher, absurder Kontrast zu ihrer Rolle als gesellschaftlich geehrte und mehrfach preisgekrönte Kulturschaffende!
"Das Wasser gfallt mir gar nit"
In ihren Kindheitserinnerungen "Innen und aussen", die nach ihrem Tod in der Textsammlung "Der letzte Frühlingstag" 1997 bei Luchterhand, München, veröffentlicht wurden, räumt sie selbstkritisch ein, dass "man es mit mir nicht leicht hatte, denn ich war kein anhängliches Kind". Bei „Ausflügen in DIE WELT“ sei für die kleine Adelheid nicht „eine Zeit der Wunder“ ausgebrochen. Als sie von ihren Eltern als kleines Kind zum ersten Mal an einen See geführt worden sei, habe sie trocken festgestellt: „Das Wasser gfallt mir gar nit“. Aber damals war`s der Vierwaldstättersee, nicht „das grosse Wasser“, das Meer, das die Binnenländerin erst viel später, als über dreissigjährige verheiratete Frau, kennenlernen sollte.
„Einmal auf Formentera gewohnt“
„Vielleicht war das wirklich ihr einziger Schritt hinaus in die Welt“, vermutete der Literaturkritiker Reinhard Baumgart in der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ am 3. Januar 1992 über den Formentera-Aufenthalt der „Autorin, deren Verlag in einer atemberaubend knappen Biographie mitteilt, sie wäre 1936 in Basel geboren, lebe immer noch dort und habe einmal, und zwar 1968/69, auf Formentera gewohnt“.
Was der Literaturrezensent der „Zeit“ kaum wissen konnte: Die Schriftstellerin selbst hatte schon 1967 in einem Erlebnisbericht, der damals (am 16. Juli 1967) im „Sonntagsblatt“ der „Basler Nachrichten“ erschienen war, ihre bisherige Reiseabstinenz selbstironisch offenbart.
Autofahrt nach Südfrankreich
„So unglaubwürdig es tönt“, schrieb sie in dieser mit „Eine Reise ans Meer“ überschriebenen Erzählung, „wenn jemand heutzutage erklärt, er habe sein Land noch nie verlassen (sogar der nichtsnutzige, nicht mit irdischen Gütern gesegnete Onkel Röbi oder Emil schickt, um seine Verwandten zu ärgern, eine Karte aus Griechenland): Ich war tatsächlich noch nie am Nordpol, in Afrika, in Indien oder `in den Staaten` - und noch nie am Meer.“ Immerhin ließ sie die Leserinnen und Leser auch wissen: „Da ich aber, wie es sich gehört, einen Pass mit einer scheußlichen Foto besitze, unternahm ich hie und da einen Abstecher ins Elsass oder in die badische Nachbarschaft - weil ich mit besagter Foto die Grenzbeamten necken wollte: `Bin ich`s oder bin ich`s nicht?` Um mich zu beleidigen, nahmen sie immer an, ich sei`s.“
Nun aber rollt sie „im Oxford meines Bekannten gen Süden“, genauer Richtung Südfrankreich, wo sie nach einer Tagesreise abends in Les-Saintes-Maries-de-la-Mer aus dem Auto klettert und zum ersten Mal in ihrem Leben - als Einunddreissigjährige - des Meeres ansichtig wird.
„...wäre das Meer geisteskrank“
„Es ist tiefblau“, schildert sie ihren ersten Eindruck. „Grosse Wellen tragen Sonnensplitterchen gegen das Ufer, doch kurz vor ihrem Ziel bersten sie und zerfallen schäumend; die Sonnenfunken haben sie vielleicht getötet. Einigen Wellen aber muss es doch gelungen sein, ihre kostbare Last auf den Sand zu legen, denn er funkelt, als ob er von winzigen Edelsteinen durchsetzt wäre. Der Sand ist wie warmer Zimt, wenn ich meinen nackten Fuß hineinbohre. Würden plötzlich all die sonderbaren Lebewesen, die in der Tiefe ihr fremdartiges Leben führen, an die Oberfläche steigen, die Wellen teilen, ihren Rhythmus stören, wäre das Meer geisteskrank. So aber ist es gesund: Nur der Wind, der Himmel und die Sonne oder der Mond verändert es.“
Dieser Text blieb übrigens, wie viele andere Feuilletons, Essays und Satiren der aus existentieller Notwendigkeit damals auch als Buchrezensentin arbeitenden Dichterin, jahrzehntelang unbeachtet; bis zur Jahrhundertwende ist er in keiner Buchpublikation zu finden, auch nicht in der 1997 bei Luchterhand postum erschienenen Sammlung „Der letzte Frühlingstag“. Erst anfangs Zweitausend wurde er von mir, dem älteren Bruder der Schriftstellerin, „ausgegraben“ und dem Verlagsleiter Dirk Vaihinger zur Verfügung gestellt, der die autobiographische Erzählung an Peter von Matt weiterleitete, der sie in den 2004 bei Nagel & Kimche in Zürich herausgegebenen Geschichtenband „Beim Hute meiner Mutter“ aufnahm.
„Unglaublich hell“
Adelheid Duvanels erste Begegnung mit dem Meer ist auch in einem privaten Brief authentisch festgehalten. „Jetzt gerade schreibe ich auf einer Bank am Meer“, schrieb sie am 15. Juni 1967 aus Südfrankreich an ihre in Liestal wohnenden Eltern; „das Papier muss ich mit Steinen beschweren, aber die Sonne brennt heute besonders heiß, so dass der Mistral nicht unangenehm ist. Es ist unglaublich hell hier; alles ist wie in eine leuchtend weiße Milch getaucht - einen so hellblauen Himmel habe ich in meinem Leben noch nie gesehen! (...) Auch die französischen Maler werden verständlicher; ihre Farbzusammenstellungen, die uns fremdartig dünken, gibt es hier wirklich! Z.B. eine grellgrüne Türe in einem Restaurant und dazu rosa Tischtücher.“
Aufbruch nach Formentera
Jene Reise nach Südfrankreich, der erste Aufenthalt am Meer, ließ in Adelheid Duvanel den Entschluss reifen, kein Jahr später, im Frühjahr 1968, mit der kleinen Tochter ihrem Mann, dem Maler Joseph E. Duvanel, auf die Balearen zu folgen. Einen lebendigen Einblick in die Reise und Ankunft der nach Formentera auswandernden Familie Duvanel, das Inseldasein in der mediterranen „Wildnis“ sowie die von Ernüchterung geprägte Rückkehr ins vertraute und doch so fremd gewordene Basel, wo sie eine Arbeit als Bürolistin annehmen musste, vermitteln drei satirische Feuilletons der Schriftstellerin, die in jener Zeit in den „Basler Nachrichten“ publiziert wurden.
Der erste Teil dieser feuilletonistischen „Formentera-Trilogie“ erschien am 16. Mai 1968 unter dem Titel „Keinen Ärger mehr“. Darin erklärt die junge Mutter und Ehefrau Adelheid Duvanel den „BN“-Leserinnen und Lesern, ihr Mann und sie hätten „beschlossen, auf eine kleine Insel auszuwandern und die vierjährige Tochter mitzunehmen“. Sie werde sehen, es würde paradiesisch, habe ihr Mann beteuert, „keinen Ärger mehr mit Nachbarn und so.“ - „Mit zwei Koffern, zwei Taschen, meiner Schreibmaschine und der Staffelei meines Mannes sitzen wir im Zug und rollen gen Süden.“
Es folgt die (selbst)ironische Schilderung der Komplikationen (und Ärgernisse), die den Emigranten schon auf der Reise widerfahren, der Bekanntschaft mit einem Ehepaar aus Köln namens Maunz. In Barcelona finden dieses „Ehepaar, seine beiden Kinder, seine siebzehn Gepäckstücke und wir keinen Platz mehr auf dem Schiff. Not verbindet; wir kommen ins Gespräch und erstarren vor Verwunderung: Das Ehepaar ist nicht ein gewöhnliches Touristenehepaar, sondern wandert auch aus.“ - Auf der Insel angelangt, „wird die Familie Maunz auffallend selbstbewusst: Zielstrebig blickt ihr Auge, die Rücken straffen sich, ihre Antworten werden kapp und, so stelle ich beunruhigt fest, leicht von oben herab erteilt. Des Rätsels Lösung: Papa Maunz erklärt, sie führen nun mit dem Taxi zu ìhrem Haus. Aha, sie haben ein Haus.“
„Das ist der Süden“
Der Tag endet für die Familie Duvanel in einer Notunterkunft im Haus des deutschen Ehepaars: „Ängstlich liegen wir zu dritt in einem Bett in einem kahlen Zimmerchen und lauschen auf den Wind; der Ziehbrunnen knarrt, die Pinien ächzen, der Sand rieselt an die Fensterscheibe. AmMorgen regnet es, oder besser gesagt: es wird mit dicken Schläuchen Wasser vom Himmel gespritzt, dazu heult und pfeift ein fürchterlicher Wind. Wenn wir sprechen, hallt es unheimlich von den Wänden. Ich habe Rheuma. Wie sich herausstellt, sind nicht nur die Leintücher feucht, sondern auch die Zündhölzer; wir können weder die Kerze noch die Petrollampe noch den Gasherd anzünden. So sitzen wir im Halbdunkel, stellen uns vor, wir würden Kaffee trinken und betrachten die feuchten Flecken an Wänden und Decke. Der Steinboden ist kalt. Mein Mann hat Halsweh, unsere Tochter Fieber, die Kinder von Mauzens Bauchweh; jedesmal, wenn sie auf der Toilette waren, geht Mama Maunz am Ziehbrunnen Wasser holen, um zu spülen. `Das ist der Süden`, sagt Papa Maunz. Wir verstehen ihn nicht. Papa Maunz räuspert sich: `Das ist der Süden`, wiederholt er streng. Wir schweigen staunend.
Seither sind fünf Wochen verstrichen. Wir haben das Haus neben Maunzens gemietet. Die Sonne scheint, die Fliegen tanzen auf unseren Nasen, die Kakteen stehen bizarr herum und die Ziegen hoppeln mit zusammengebundenen Füssen über das spärliche Gras. Im Gärtchen, das aus Sand besteht, hat mein Mann aus Backsteinen und mit Drähten einen Grill gebaut; wir kochen dort, um Gas zu sparen. Papa Maunz, der am Anfang täglich stolz: `Flucht vor der Zivilisation!` brüllte und in Shorts den Eimer des Ziehbrunnens hochzog, ärgert der Rauch; sogar seine Kinder sagen schon laut: `Die verpesten wieder die ganze Luft`.“
Formentera beschrieb die Schriftstellerin aber auch in vielen privaten Briefen. Am 8. Juni 1968 berichtete sie mir nach Basel: „Jetzt liege ich am Strand, es ist heiß, heiß, heiß, das Hirn gelähmt, das Meer wie blaues Licht, der Himmel darüber viel zu hoch, man sieht die Sonne nicht, aber sie liegt wie heißes, flüssiges Glas überall.“
Und fast ein Jahr später, am 3. Mai 1969, wenige Monate vor der Rückkehr in die Schweiz, schrieb sie mir: „Nach drei Tagen Sintflut ist der Sommer nun anscheinend angebrochen; zwar ist unser kleines Haus trotz der Sonne, die vom Himmel brennt, von Winden umtobt, denn es liegt ungeschützt auf einer Anhöhe. Wir, seine stolzen Bewohner, lassen den Blick nach allen Seiten hin ungehindert in blaue Fernen schweifen. Wir sehen von drei Seiten das Meer, sehen Pinien und Agaven, sehen Ziegen und Schafe und Ziehbrunnen. Vor unserem Haus blühen wilde und zahme Geranien in üppiger Pracht“.
Rückkehr nach Basel
Die ziemlich ernüchterte Rückkehr nach Basel hielt Adelheid Duvanel in einem Feuilleton fest, das am 10. September 1969 in den „Basler Nachrichten“ abgedruckt wurde.
„Ich war längere Zeit abwesend“, meldete sie sich ihrer Leserschaft zurück, „nun bin ich vor einer Woche vom Ausland zurückgekehrt und habe erledigt, was getan werden musste: Die Koffer ausgepackt, die schmutzige Wäsche gewaschen, die Wohnung geputzt, Einwohnerkontrolle, Telephon- und Postamt verständigt und drei Bekannte besucht. Nun sitze ich in der Wohnung; es ist kalt, vor meinem Fenster steht - das ist die Wahrheit, nicht einem tristen Roman entnommen - eine graue Backsteinmauer, der Himmel drüber ist wie Eiweiss und die Wäsche auf dem Balkon hängt schlapp da, weil es nicht windet. Ich habe mir einen hässlichen Wecker gekauft (ich nehme an: hässlich, weil billig); er tickt, als ob jemand auf steifen Füsschen auf dem Tisch herumrennen würde. Ich muss nämlich jeden Morgen um sechs aufstehen, weil ich in einem Büro arbeite, das man nur erreichen kann, nachdem man verschiedene Prüfungen auf sich genommen hat, so kostbar ist dies Büro: ein Paradies, zugänglich nur dem Geduldigen, Opferwilligen. Ich fand blitzschnell eine Stelle, weil ich mich an eine Organisation wandte, die Arbeitskräfte vermietet. Die Organisation zeigte mir Lichtbilder, denen ich entnehmen konnte, dass durch sie vermietete weibliche Arbeitskräfte elegante Nylonstrümpfe, ebensolche Pumps, ein diskretes Make-up und eine von einem gewitzten Friseur mittels leichter Dauerwelle, Haartönung und -lack gefällig zurechtmodellierte Frisur aufweisen.“
„Eine Stunde Büro aufgegessen“
Im selben Feuilleton schrieb sie: „Das Ganze kam mich etwas teuer zu stehen (die Haartönung hat gottseidank die südliche Sonne während des ganzen Sommers besorgt), doch ich hoffe, es macht sich bezahlt. Stundenlohn hat übrigens einen Nachteil; wenn ich mir in einem Restaurant ein mittelfeines Mittagessen leiste, fällt mir zwanghaft ein: `Nun hast du eine Stunde Büroarbeit (kalte Füsse, leere Wände, ein silbenschluckendes Diktaphon) aufgegessen.`
Am Nachmittag habe ich frei, dann gehe ich als ich selber durch die Strassen; die Menschen scheinen es immer eilig zu haben, dazu machen sie Gesichter, als ob sie in rohe, hölzerne Rüben gebissen hätten; das stimmt mich nachdenklich. Sind sie nicht glücklich?“
Formentera wurde Refugium
Die befristete Emigration auf die spanische Mittelmeerinsel blieb nicht bloß eine Randnotiz in der Biographie dieser Basler Autorin, sondern sie prägte deren weiteres Leben und beeinflusste auch ihr Schreiben. Die Geschichten der Schriftstellerin sind seit deren Aufenthalt auf Formentera nicht mehr nur von mitteleuropäischen Stadthockerinnen und -streicherinnen bevölkert, sondern auch von Inselbewohnern, und in die Texte schleichen sich immer wieder mediterrane Landschaftsbilder ein. Für Adelheid Duvanel und ihre später schwerkranke Tochter, die im Herbst 2004, acht Jahre nach dem Suizid der Mutter, auf den Balearen gestorben ist, wurde Formentera Refugium, zweite Heimat.
*
Jahre nach dem Tod von Adelheid Duvanel habe ich die hier erwähnten Briefe und Feuilletons, zusammen mit anderen in den Sechzigerjahren zum Teil unter dem Pseudonym Judith Januar in den „Basler Nachrichten“ veröffentlichten Texten, darunter auch Essays und journalistische Auftragsarbeiten, aus meinem Privatarchiv dem schweizerischen Literaturarchiv in Bern übergeben und damit der Literaturforschung und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Felix Feigenwinter