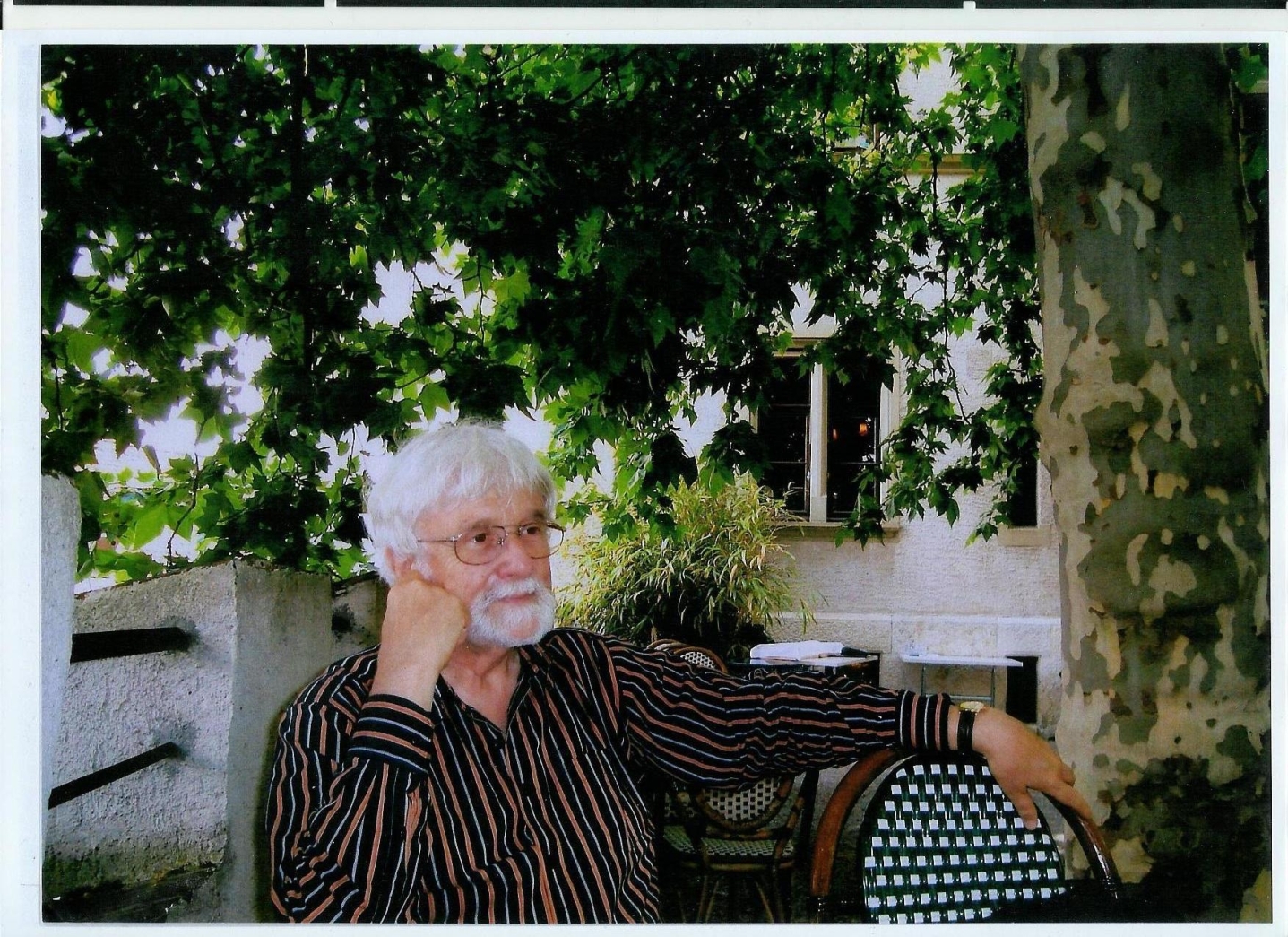LINKS ODER RECHTS?
In den 1970er Jahren versuchten Repräsentanten politischer Parteien vergeblich, mich einzuspannen. Als Journalist hatte ich aufklärerisch gewirkt, z.B. für die Entkriminalisierung der Militärdienstverweigerer aus Gewissensgründen und für die straflose Schwangerschaftsunterbrechung (Fristenlösung) argumentiert. Ich schrieb Artikel gegen den Bau des Atomkraftwerks Kaiseraugst, setzte mich für die Besserstellung alleinstehender Mütter und ihrer Kinder ein. Ungewollt erwarb ich mir den Ruf eines “Linken”. Ein “Progressiver” wollte mich auf eine Parteiliste für die Grossratswahlen setzen – doch ich lehnte ab. Und als mir ein Vertreter des damaligen “Landesrings der Unabhängigen” (kein “Linker” im marxistisch-sozialistischen Sinn, aber ein kämpferischer AKW-Gegner) eine Stelle im Basler Parteisekretariat anbot, verweigerte ich mich mit der Begründung, ich wünschte parteipolitisch unabhängig zu bleiben – auch von den “Unabhängigen”…
Heute nun, alt geworden und parteilos geblieben, wurde ich (längst nicht mehr Berufsjournalist, sondern gelegentlicher Leserbriefschreiber) mit dem Urteil konfrontiert, meine jüngsten Meinungsäusserungen seien “konservativ”. Aus der “linken” werde ich jetzt also offenbar in die “rechte” Ecke geschoben. Aber nach wie vor hinterfrage ich ideologische Phrasen und plappere keine Parteiparolen nach – ich bleibe skeptisch und kritisch. Kurzum: Ich denke und schreibe weiterhin weder “links” noch “rechts”, sondern selbständig.
Felix Feigenwinter, Basel, im Mai 2014
Journalistische Nachtarbeit in den frühen
Sechzigerjahren
Bild unten: Nachtarbeit in der Dachkammer, eine Normalität im Leben des freien Journalisten. Der Bericht über eine Abendveranstaltung musste im Morgenblatt erscheinen und deshalb bis zum Redaktionsschluss um fünf Uhr früh geschrieben und abgeliefert sein. Damals gab’s noch keine Computer, keine Laptops, kein Internet; der Journalist schrieb den Artikel aufgrund seiner handschriftlichen Notizen bei sich zu Hause auf seiner geräuschgedämpften mechanischen Schreibmaschine, einer sogenannten Noiseless (damit die schlafenden Nachbarn nicht gestört wurden), und trug dann das Manusript bzw. Typoskript vom Spalenberg in der Basler Altstadt, wo er damals wohnte, mitten in der Nacht eigenhändig zur Dufourstrasse, wo sich die Redaktion, die Setzerei (damals noch Blei-Setzerei) und Druckerei der “Basler Nachrichten” befanden. Schon nach sechs Uhr war dann der Artikel im druckfrischen Morgenblatt zu lesen. Und der neue Arbeitstag begann oft noch am selben Morgen mit einer Presseorientierung irgendwo in der Stadt oder auf dem Land. Die Übergänge zwischen Tag- und Nachtarbeit waren fliessend.

FREUDE TROTZ MICKERIGER HONORARE - ERINNERUNGEN ANS JOURNALISTENLEBEN IN DEN NEUNZEHNHUNDERTSECHZIGERJAHREN
Auszug aus einem Brief vom 4. Januar 2015 an einen Bekannten:
"Meine ins Schaufenster des Internets gestellten journalistischen Texte sind nur ein winziger Teil der unermesslichen Textmenge, die ich im Verlauf meiner über zwanzigjährigen journalistischen Karriere erarbeitet habe. Einerseits ist dies gewollt, eine bewusste Beschränkung auf einige Beispiele eines kreativen Journalismus` jenseits des alltäglichen Pflichtprogramms, anderseits jedoch geschah es notgedrungen, weil viele interessante Artikel im lückenhaften Archiv gar nicht mehr vorhanden waren. Absichtlich nicht gezeigt werden unzählige Routine-Artikel (Berichterstattungen über Pressekonferenzen, Unglücksfälle und Verbrechen, Gerichtsberichte - während rund vier Jahren war ich regelmässiger Gerichtsberichterstatter der "Basler Nachrichten" und der Schweizerischen Depeschenagentur - , kleine Reportagen über diverse politische und gesellschaftliche Anlässe usw.). Nicht berücksichtigt ist sodann eine riesige Anzahl von Interviews mit Grossrats-, Landrats-, Nationalrats-, Ständerats- und Regierungsratskandidaten, die ich jeweils vor den Wahlen produzierte (Ausnahmen: die Interviews mit den Basler Regierungsratskandidaten Helmut Hubacher und Hansjörg Hofer aus dem Jahr 1976). Auch umfangreiche Reportage-Serien wie z.B. jene über "Baselbieter Dörfer" fehlen in der Internet-Präsentation.
Ich erinnere mich, dass mir die Basler Nachrichten in der ersten Hälfte der Sechzigerjahre für eine sogenannte Dorfreportage sage und schreibe vierzig Franken bezahlten. Mein Aufwand: in der Regel zwei Arbeitstage - fast ein ganzer Tag in der betreffenden Ortschaft mit Interviews z. B. mit dem Gemeindepräsidenten, dem Dorfpolizisten, dem Gemeindeverwalter, mit Bauern und Bäuerinnen, mit einem im Dorf wohnenden Künstler, einer prominenten einheimischen Sportlerin, mit dem Pfarrer, dem Milchmann und der Briefträgerin, dem "Ochsen"- oder/und "Rössli"-Wirt usw.; ein weiterer, zweiter Tag Recherchen im Staatsarchiv betreffend historische Informationen und schliesslich die Schreibarbeit d.h. Verfassen des Textes. (Natürlich, der Frankenwert war damals mehrfach höher als heute. Und einige meiner für die "Basler Nachrichten" geschriebenen Reportagen konnte ich Zeitungen in anderen Regionen anbieten; sie erschienen z.B. auch im "St. Galler Tagblatt" und in der "Solothurner Zeitung". Das ergab willkommene Honorar-Zustüpfe.) - Ähnlich relativ mickerig waren die übrigen Honorare, mit denen ich damals als junger selbständiger Berufsjournalist mein Dasein zu finanzieren hatte. Trotzdem freute ich mich fürstlich - ich genoss meinen Status als freier kreativer Schreiber, liebte meine Arbeit." (Felix Feigenwinter, 4.1.2015)


Der Journalist Felix Feigenwinter, Basel, zu den Themen:
- Basel tickt anders
- Kultur in Basel
- Atomkraftwerke, kriegerische und friedliche radioaktive Bestrahlung
- Frauen in der Politik
- Meinungsfreiheit
- Toleranz und Gewalt
- Prostitution weiblicher Sexualität
- Sexueller Missbrauch von Kindern
- Zuwanderung
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Basel tickt anders
Basler ticken anders
Kommentar zu Helmut Hubachers Kolumne „Agenda“ in der „Basler Zeitung“ vom 3. September 2016:
Markus Somms Wahlkampf-Kritik und Christoph Eymanns Widerworte haben das am Rheinknie seit Jahrzehnten in Schnitzelbängg sowie im Bereich Fussball schwelende und gepflegte Rivalitätsverhältnis zwischen Basel und Zürich auf politischer Ebene befeuert.* Auch Helmut Hubachers Feststellung, in Zürich kämpfe man mit offenem Visier, gern messerscharf, während in Basel die heimtückische Masche gepflegt werde, weist auf den Kern der Auseinandersetzung: auf einen Mentalitätsunterschied zwischen Baslern und Zürchern – ein Thema, das nicht nur Fasnächtler, Fussballfans und Politiker beschäftigt. Der soeben pensionierte langjährige Direktor des Basler Kunstmuseums, Bernhard Mendes Bürgi, ein Ostschweizer, reflektierte vor seinem Abgang: „Ich hatte den Eindruck, dass Basel im Vergleich England ist und Zürich Amerika. Zürcher sind unkomplizierte Macher. Wenn sie Erfolg haben, zeigen sie es unverblümt – was man in Basel nicht tut.“ Kardinal Kurt Koch, ein Luzerner, früher Bischof von Basel, meinte einst ironisch: „Die Basler müssen immer erst eine Larve anziehen, um ihre Masken ablegen zu können.“
Felix Feigenwinter, Basel
*Zum besseren Verständnis: BaZ-Chefredaktor Markus Somm, der sich einen kämpferischeren Wahlkampf in Basel wünscht, spricht Züridütsch (eigentlich aargauischer Dialekt aus der Zürich-nahen Region Baden, der in Basler Ohren zürcherisch klingt); der in Basel geborene und aufgewachsene, zurücktretende Regierungsrat Christoph Eymann, der Somm in einer Replik dezidiert widersprach, spricht reines Baseldytsch.
Wunderliche Basler
Leserbrief von Felix Feigenwinter betreffend Interview „Die Basler wollen sich spüren“ in der BaZ vom 13.4.18:
Filippo Leutenegger, Zücher Stadtrat und vorübergehend BaZ-Verleger, fragt, warum „die reichen Basler“ nichts unternommen hätten, um die Basler Zeitung zu erwerben. Schon vor 40 Jahren wunderten sich Fusionsgegner, dass Angehörige des Basler „Daigs“ nichts unternahmen, damals die Verschmelzung der liberal-konservativen Basler Nachrichten mit der mehr links positionierten National-Zeitung zur Einheitskost Basler Zeitung zu verhindern. Dass dann die Rettung der letzten Stadtbasler Tageszeitung (früher waren’s vier!) namens Basler Zeitung einem Nichtbasler aus dem zürcherischen Herrliberg (Christoph Blocher) vorbehalten blieb, führte zur Boykott-Aktion „Rettet Basel!“ – eine skurrile Pointe der wunderlichen Realsatire. Wegen des Boykott-Widerstands linker Kreise verlor die "BaZ" Abonnenten und Blocher die Freude an der Zeitung, die er schliesslich an das Medienunternehmen Tamedia aus Zürich verkaufte. Tamedia ersetzt den bisherigen liberalen Chefredaktor Markus Somm, ein akademisch gebildeter Historiker und eigenwilliger, intellektuell brillanter Kommentator politischer Vorgänge, durch den Sportredaktor Marcel Rohr und zieht die politisch prägenden, national und international gewichtigen Inland- und Auslandredaktionen aus Basel ab - ein absurdes Ergebnis von "Rettet Basel".
Felix Feigenwinter, Basel
PS. Am 18. April 2018 erschien in der "Neuen Zürcher Zeitung" ein Interview mit der Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann, in welchem diese auf die Frage “Wo liegen die Unterschiede der beiden Städte?” antwortete: “Es sind gewisse Mentalitätsunterschiede auszumachen. In Basel macht man oft auf Understatement, in Zürich zeigt man eher, was man hat und kann.” Und auf die Frage “Was kann Zürich von Basel lernen?” meinte Frau Ackermann: “Eine Portion Selbstironie”. Diese komme am Zürcher Sechseläuten im Vergleich zur Basler Fasnacht schon etwas zu kurz. – In einem Kommentar fragt David Sieber in der "Schweiz am Wochenende" vom 21. April 2018: “Ist es eine Beleidigung oder ein Kompliment, wenn Christoph Blocher Basel als eine ‘eigene Region, die nicht schweizerisch sein will’ bezeichnet? Er sagte das am Mittwoch an der Pressekonferenz zum Verkauf der Basler Zeitung an Tamedia. Dies als Begründung, weshalb er die Zeitung nicht auf der nationalen Bühne verankern konnte. Blocher wirkte dabei resigniert. Verstärkt wurde dieser Eindruck durch sein Eingeständnis vor versammelter BaZ-Redaktion, es sei wohl ein Fehler gewesen, die Zeitung zu übernehmen. Blocher wurde nie warm in Basel. Das liess er immer wieder mal durchblicken. Weil die Region tatsächlich nicht seinem Schweiz-Bild entspricht.”
_______________________________________________________
Kultur in Basel
RESIGNATION WEICHT NEUEM OPTIMISMUS
Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 3. Juli 2015 in der „Basler Zeitung“ als Kommentar zur Wahl des neuen Direktors des Kunstmuseums Basel:
Als bewundernder Besucher des Kunstmuseums seit meinen Jugendjahren wiegte ich mich Jahrzehnte lang im Glauben, Basel erfreue sich einer weltweit einzigartigen Kunstsammlung. Dass manche der hier versammelten Schätze aus 700 Jahren europäischer Kunstgeschichte im Besitz von privaten Stiftungen sind, etwa die hochkarätigen Leihgaben aus der Rudolf-Staechelin-Sammlung, beeinträchtigte meine Begeisterung nicht.
Doch dann die ernüchternde Meldung, dass ausgerechnet die repräsentativsten Bilder der impressionistischen und nachimpressionistischen Meister aus dem Museumsangebot verschwinden sollen, weil der Staechelin-Family Trust über sein Eigentum anders verfügen will… Ein Schock für viele Kunstliebhaber, wie mir Gespräche mit anderen Museumsbesuchern bestätigten, die zum Teil gar unverhohlene Wut über den vermuteten fehlenden Einsatz der (des) politisch Verantwortlichen ausdrückten… Aber nun dies: Die Wahl des hochgelobten neuen Museumsdirektors Josef Helfenstein (nomen omen est?) lässt wieder hoffen. Da kann sich auch der als Kulturminister umstrittene Guy Morin in neuem Glanz sonnen.
Felix Feigenwinter, Basel
ADELHEID DUVANEL WIRD NICHT ERWÄHNT
Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der „Basler Zeitung“ am 5. Dezember 2015:
Im Hinblick auf eine Veranstaltung im Literaturhaus Basel erwähnt Christine Richard Charles Linsmayers Publikation „Gesichter der Schweizer Literatur“. Diese Anthologie ist umstritten. Im Internet lese ich, dass auch der Schriftsteller Claude Cueni diverse Gesichter in der scheinbar umfassenden Sammlung vermisst, zum Beispiel das von Hansjörg Schneider (den ich unter anderem als Autor des „Sennentuntschi“ und des „Schützenkönig“ sehr schätze). Cueni vermutet den Erfolg der von ihm vermissten Autoren als Ausschlusskriterium – ein Verdacht, den ich nicht teile, denn in Linsmayers Buch sind auch Bestsellerautoren vertreten.
Jedoch vermisse ich das Gesicht einer bemerkenswerten Aussenseiterin: Es fehlt die Basler Luchterhand-Autorin Adelheid Duvanel (1936-1996), die 1984 mit dem Kranichsteiner Literaturpreis und 1987 mit dem Literaturpreis der Stadt Basel geehrt wurde und die Peter von Matt in seinem Buch „Die tintenblauen Eidgenossen“ angemessen würdigte. Linsmayer Inkompetenz zu unterstellen, wäre sicher abwegig, aber die Frage nach der Absicht bleibt offen.
Felix Feigenwinter, Basel
POSTUME ANERKENNUNG DER MALERIN ADELHEID DUVANEL
Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 3. Juni 2016 in der bz / nordwestschweiz, betr. Artikel von Martina Kuoni „Wenn der Alltag zum Ungeheuer wird“ in der „Basellandschaftlichen Zeitung“ vom 21. Mai 2016.
Martina Kuoni sei gedankt für ihr aufmerksames und subtiles Gedenken anlässlich des 80. Geburtstags der in Pratteln und Liestal aufgewachsenen Basler Luchterhand-Autorin Adelheid Duvanel (1936-1996). Ergänzend sei daran erinnert, dass die ebenso aussenseiterische wie bemerkenswerte Schriftstellerin zuerst im Ausland etablierte Anerkennung fand (1984 mit dem Kranichsteiner Literaturpreis), bevor sie in ihrem Heimatland entsprechend geehrt wurde (1987 mit dem Basler Literaturpreis, 1988 mit dem Gesamtwerkspreis der Schweizer Schillerstiftung und 1995 mit dem Gastpreis der Stadt Bern). In seinen Büchern «Die tintenblauen Eidgenossen» (2001) und «Das Kalb vor der Gotthardpost» (2012) reflektierte der Literaturprofessor Peter von Matt postum über die eigenwilligen Geschichten dieser besonderen Repräsentantin der Schweizer Literatur aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Malerin fand Adelheid Duvanel erst nach ihrem Tod öffentliche Beachtung, zuerst 1997 in einer Gedenkausstellung im Kunstmuseum Solothurn im Rahmen der damaligen Literaturtage, später dann 2009 in der Ausstellung «WÄNDE dünn WIE HAUT», einer umfassenden Präsentation des zeichnerischen und malerischen Werks der Künstlerin im «Museum im Lagerhaus» in St. Gallen, wo die Museumsleiterin Dr. Monika Jagfeld das in Basel ignorierte Werk kompetent analysierte.
Felix Feigenwinter, Basel
Ausstellungskatalog "Wände, dünn wie Haut" des Museums im Lagerhaus, St. Gallen, mit Bildern und Texten der Malerin und Schriftstellerin Adelheid Duvanel-Feigenwinter und einer umfassenden und fundierten Analyse von Kuratorin Dr. Monika Jagfeld (Sonderausstellung 2009):
https://unterricht.phwa.ch/wp-content/uploads/2017/07/Duvanel-Bilder-und-Texte.pdf
*****
Hat mangelndes Fingerspitzengefühl der Basler Regierung oder/und anderer einflussreicher Kreise dazu geführt, dass grosse Teile der weltbekannten Kunstsammlung von Robert von Hirsch für Basel verloren gingen? Baron von Hirsch war Jude und musste 1933 aus seiner Heimatstadt Frankfurt vor den Nazis nach Basel fliehen, wo er sich an der Engelgasse niederliess. Aus Dankbarkeit habe der 1977 94jährig verstorbene Wahlbasler seinen wertvollen Kunstschatz der Stadt Basel vermachen wollen – unter gewissen Bedingungen, war zu erfahren. Aber Basler Instanzen hätten diese Chance vermasselt. Im Juni 1978 wird die Sammlung in London versteigert.
Alibi-Übung
Von Felix Feigenwinter
Auf den ersten Blick scheint die Situation verworren. Auf der einen Seite rühmt sich „Basel, die Kunst- und Museumsstadt“ immer noch der Pioniertat einer kunstbegeisterten Öffentlichkeit vor gut einem Jahrzehnt. Damals hatten die städtischen Stimmbürger ihre Kunstfreundlichkeit in einer einzigartigen Demonstration unter Beweis gestellt: Nachdem der Grosse Rat sechs Millionen Franken bewilligt hatte, um zwei gefährdete Picasso-Bilder aus dem Rudolf Staehelin-Depositum dem Kunstmuseum zu erhalten, wurde in der Öffentlichkeit ein „Bettler-Fest“ durchgeführt. An diesem wurden die für den Kauf dieser beiden Kunstwerke nötigen restlichen 2,4 Millionen „zusammengetrommelt“. Das Referendum, das gegen den Grossrats-Beschluss ergriffen worden war, konnte es nicht verhindern: Mit grossem Mehr sanktionierte das Basler Stimmvolk den ebenso grosszügigen wie kunstfreundlichen Parlamentsentscheid. Die Stadt Basel, deren Kunstmuseum schon lange vorher (auch ohne Picasso) Weltruhm genoss, wurde in der internationalen Presse mit Lorbeeren bedacht. Den greisen Pablo Picasso hatte die Nachricht derart gerührt, dass er vier andere seiner Werke als Geschenk „nachlieferte“, und Maja Sacher steuerte aus ihrem Privatbesitz „in Dankbarkeit und Freude“ ein weiteres bei. Ihrer reichhaltigen, vor allem von einzelnen Kunstliebhabern und -sachverständigen zusammengetragenen und bewahrten Kunstsammlung aus dem Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert hatten sich die Basler damals, in der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre, als würdig erwiesen. Das „Bekenntnis zu Picasso“ erwies sich als ein Bekenntnis zu einem ideellen Wert – zu einem Kulturgut, das zwar für Millionen für Basel gerettet, damit aber nur symbolisch „bezahlt“ werden konnte. Das Basler Volk, so schien es, hatte das damals begriffen. Die im Besitz von Basel befindlichen Picasso-Helgen bilden heute zusammen mit den spätmittelalterlichen Werken aus dem Amerbach-Kabinett, den Sammlungen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert sowie mit dem alle wichtigen Stilrichtungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vertretenden jüngeren Sammelgut das Aushängeschild nicht nur des Kunstmuseums, sondern der „Museumsstadt Basel“ überhaupt. Dass ein wesentlicher Teil der modernen Werke übrigens aus jenen Beständen stammen, welche Hitlers Barbaren als „entartete Kunst“ bezeichnet hatten, sei nicht vergessen.
Auf der anderen Seite: Nur wenige Jahre nach dem glanzvollen Picasso-Bilder-Kauf regte sich aus dem (fast) gleichen Basler Volk heftige Opposition, nachdem die mit Steuergeldern berappte „Heuwaage-Plastik“ von Michael Grossert aufgestellt worden war – wobei notabene der Geldpreis für jenes Werk nicht einmal ein Prozent von jenem Betrag ausmachte, den die Basler keine zehn Jahre zuvor für die beiden Picasso-Helgen ausgelegt hatten... Und wenige Monate später provozierte die Anschaffung von Joseph Beuys' „Feuerstätte“ fürs Kunstmuseum einen weiteren öffentlichen Krach – auch jenes Werk hatte einen winzigen Bruchteil jener Millionen gekostet, die ein Jahrzehnt zuvor Steuerzahler und freiwillige Spender für zwei Picasso-Bilder hingeblättert hatten.Was war geschehen? Hatte die Basler Bevölkerung einen grundlegenden Sinneswandel durchgemacht? Waren's die schlechteren wirtschaftlichen Zeiten, der leer gewordene Staatssäckel oder/und die allgemeine Staatsverdrossenheit, welche die Rheinknie-Bewohner von generösen Kunstfreunden zu unduldsamen, geizigen Verächtern staatlicher Kunstförderung gemacht hatten?
Eine solche Schlussfolgerung könnte jenen gefallen, welche die „Affäre von Hirsch“ direkt oder indirekt zu verantworten haben. Gäbe das nicht eine bequeme Entschuldigung ab für die Unterlassungssünde, nicht mit aller Kraft und Entschiedenheit das von Robert Hirsch offenbar wiederholt in Aussicht gestellte Vermächtnis ermöglicht zu haben? Den Verantwortlichen, die sich in dieser Sache von Amtes wegen für die Interessen der Stadt Basel hätten einsetzen sollen, musste eines nicht verborgen geblieben sein: Dass viele jener Bürger, die gegen Grosserts „Heuwaage-Plastik“ (beziehungsweise deren Finanzierung mit Steuergeldern) und Beuys' „Feuerstätte“ Sturm gelaufen sind, unterschieden haben zwischen „Picasso“ (und anderer „etablierter“ Kunst) einerseits und Grossert sowie Beuys andererseits. Ob in richtiger oder falscher Einschätzung der tatsächlichen Werte der Arbeiten dieser drei verschiedenen Kunstschaffenden bleibe hier dahingestellt (weil diese Frage ohnehin erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten einigermassen zuverlässig beantwortet werden kann). Als Beauftragte einer demokratischen Öffentlichkeit hätten jene Leute, die sich offensichtlich viel zu wenig – oder jedenfalls zu wenig flexibel - um das von Robert von Hirsch ursprünglich beabsichtigte Legat bemüht hatten, die differenzierte Ausgangslage besser berücksichtigen müssen, unabhängig von persönlichen Aversionen. Bereits ist in der Diskussion das Argument aufgetaucht, wonach der Wirbel um die „Heuwaage-Plastik“ öffentliche Unlust, ja Feindschaft gegenüber staatlicher Kunstförderung generell aufgezeigt habe, was die fehlende Motivation der Verantwortlichen für das (davongeschwommene) Legat von Hirsch begreiflich mache.
Das wäre sogar als Ausrede zu billig. Denn das von Robert von Hirsch der Stadt Basel vermutlich aus Verärgerung „entzogene“ Vermächtnis hätte mit Sicherheit nur Werke umfasst, die auch jenen Baslern Bewunderung abgerungen hätte, die staatlicher Förderung (noch) nicht etablierter Kunst skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen.
Dann aber vor allem auch dies: Selbst wenn der „Preis“ dieses Geschenks (wie man hört) in ungewöhnlichen Auflagen betreffend Präsentation dieser kostbaren Werke im Museum bestanden hätte, so hätte die einzigartige Gelegenheit aussergewöhnliche Massnahmen gerechtfertigt.
Die nachträgliche Aktion, die gegenwärtig Basel mit drei Steuer-Millionen an der Versteigerung der von Hirsch-Sammlung in London wenigstens einen kleinen symbolischen Teil des davongeschwommenen Legats sicherstellen soll, entpuppt sich als eine nach allem Vorangegangenen äusserst peinliche Alibi-Übung.
Als Vorbild wird sie in die an mutigen und verdienstvollen Rettungsaktionen so reiche Geschichte der öffentlichen Basler Kunstsammlung jedenfalls nicht eingehen können.
(Erschienen im "doppelstab" 21. Juni 1978)
_________________________________________________________________________________________
Atomkraftwerke
Die Weichen wurden falsch gestellt
FELIX FEIGENWINTER, BASEL
(Erschienen in der "Basler Zeitung" am 9. April 2011)
FELIX FEIGENWINTER, BASEL
Friedlich bestrahlt
Von Felix Feigenwinter
"Strahlen!" heißt ein Film, welchen die Basler Firma Kern-Film AG, im Auftrag des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz und in engster Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivilschutz, in dreijähriger Arbeit hergestellt hat. Der Presse- und Informationsdienst des Zivilschutzbundes orientiert uns, um was es hier geht: Der Gedanke eines Unfalls mit Kernwaffen dürfe nicht von der Hand gewiesen werden. Die bereits bekannten Fälle von Palomares und Thule vom 17. Januar 1966 und vom 21. Januar 1968 würden belegen, dass mit solchen Möglichkeiten leider gerechnet werden müsse. Und weiter: "Ein solcher Unfall - über dem Mittelmeer angenommen - und seine Auswirkungen auf die Schweiz..."- davon handelt der neueste Aufklärungsfilm.
Dass dieser Film einerseits unterstreicht, dass "die verantwortlichen Behörden im Rahmen des zivilen Bevölkerungsschutzes schon einiges vorbereitet und bestimmte Maßnahmen ergriffen haben", aber anderseits auch zeigt, "dass noch viel zu tun bleibt", mag einerseits beruhigen und anderseits beunruhigen.
Merkwürdigerweise ist von einer Atomkatastrophe mitten im Frieden die Rede - will sagen von einem Unfall, nicht von den Folgen eines gezielten militärischen Einsatzes. Sympathischerweise braucht man also nicht an einen Krieg zu denken... Dass uns der sogenannte Friede heute fast ebenso bedroht wie der Krieg, muss man annehmen, denn unser Zivilschutz sähe sich bei einem Atomunglück über dem ach so fernen Mittelmeer (mitten im Frieden!) veranlasst, die Chance des Über- und Weiterlebens im größtmöglichen Ausmaß zu wahren. Welch düsterer Frieden: Der Unfall über dem Mittelmeer könnte bewirken, dass auch auf unser Land radioaktiver Staub fällt und die gefährliche Strahlung uns zwingt, unseren Alltag zu unterbrechen. So schonungsvoll erklärt es uns der Zivilschutzbund...
Warum dieser für seinen Film aber nicht ein viel naheliegenderes Beispiel gewählt hat: Den Unfall eines schweizerischen Atomkraftwerkes? Vielleicht darum nicht, weil Schonung Not tut: Weil das Aufzeigen der Gefahrenquelle im eigenen Land vermehrt die unangenehme Einsicht zur (schonungslosen) Folge haben würde, dass auch die friedliche Verwendung der Atomenergie zur Katastrophe führen kann? Das wäre dem in gewissen Kreisen sorgsam gehätschelten Ruf der friedlichen Nutzung der Atomenergie in der Tat abträglich. Ob kriegerisch oder friedlich bestrahlt - die Bestrahlten werden sich für diesen feinen Unterschied allerdings kaum mehr interessieren.
(Erschienen im doppelstab 1974)
__________________________________________________________________________________________
Frauen in der Politik
Warum keine Frauen-Partei?
(Erschienen im „doppelstab“ 1975)
"doppelstab" - Februar 1975
Der Schrei nach dem "Jahr des Mannes"
Von Felix Feigenwinter
Erklungen ist der Schrei in der Leserbrief-Spalte einer Baselbieter Tageszeitung, und zwar, nachdem das so viel zitierte "Jahr der Frau" noch nicht einmal eine Lebensdauer von einem Monat hatte. Der Schrei stammt interessanterweise von einer Frau. "Ich habe das Gefühl", so schreibt die betreffende Dame mit Blick auf den Frauenkongress in Bern, "dass diese übereifrigen Frauenrechtlerinnen unzufriedene und in der Liebe enttäuschte Frauen sind. Sie sind verbittert und nun muss die ganze Männerwelt den Kopf herhalten" - Und: "Im Zeichen der Gleichberechtigung wäre ein Jahr des Mannes wohl angebracht. Wie wäre es mit 1976?"
Was gibt es zu so viel weiblicher Selbstlosigkeit (gegenüber von Männern) bzw. Selbstzerknirschung (gegenüber dem eigenen Geschlecht) aus der Sicht eines Mannes zu sagen, der die letzten Reste patriarchaler Grimmigkeit längst vor Anbruch des "Jahres der Frau" abgelegt zu haben sich rühmt und davon überzeugt ist, dass die "Entsklavung der Frau" ausser zum Wohl der Frauen und der Kinder auch sogar zum Wohl der Männer wäre?
Vielleicht dies: Es ist immer leicht, Individuen oder Gruppen, die um ihre Rechte kämpfen, als lächerlich hinzustellen - besonders dann, wenn sie mehr oder weniger rechtlos einer starken, die Macht verkörpernden Mehrheit gegenüberstehen. Bei politisierenden, ihre eigenen Interessen vertretenden Männern spricht allerdings kaum jemand im diskriminierenden Sinn von "Unzufriedenen", und ich habe auch noch nie gehört oder gelesen, dass die sich in der politischen Auseinandersetzung profilierenden Repräsentanten einer männlichen Bevölkerungsgruppe als "in der Liebe enttäuschte Männer" hingestellt werden... Dass wir alle in einem typischen Männerstaat aufgewachsen sind und uns so sehr an die männliche "Alleinherrschaft" gewöhnt haben, soll uns - vier Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts - nicht daran hindern, kämpferisch auftretenden Frauen das (demokratische!) Recht zur Formulierung ihres Unbehagens zuzugestehen. Dies umso weniger, als es diesen Frauen vorher jahre- und jahrzehntelang verwehrt blieb, ihre Anliegen wirksam vorzubringen. Und damit wäre wohl auch der meines Erachtens groteske Vorschlag nach einem "Jahr des Mannes" beantwortet: Nach einer endlosen Reihe "Jahre des Mannes" ist doch nun eigentlich wirklich die Frau an der Reihe.
Aber eben - A.R. Roth aus Basel analysiert das Problem in einem Vers schnitzelbänklerischen Zuschnitts mit scharfsinniger Ironie:
"Me wird de Fraue 's Rächt nie gää,
si miesste's scho vo sälber näh,
Doch d'Männerwält isch uff der Huet
und d'Fraue hänn viel z'wenig Muet.
Si kämpfe gege's eige G'schlächt -
solang's so blybt - hänn d'Männer rächt!"
Was, mit anderen Worten, ein Aufruf an die Solidarität der Frauen unter sich wäre.
Von uniformen Männern und uniformierten Frauen
__________________________________________________________________________________________
Meinungsfreiheit
(Erschienen im doppelstab am 1./2.Juni 1978)
__________________________________________________________________
Toleranz und Gewalt
Felix Feigenwinter, Basel
(Erschienen in der "Basler Zeitung" vom 24.12.2011)
„Weder Ideologie noch Religion“; Baz 26.7.2011
Dass Londons Stadtpräsident Boris Johnson den norwegischen Attentäter mit islamischen Selbstmordattentätern vergleicht, ist naheliegend und nachvollziehbar. Tatsächlich scheint Breivik die Terroranschläge muslimischer Gotteskrieger nachgeahmt zu haben - inhaltlich mit umgekehrten Vorzeichen. Johnsons Betrachtung erscheint mir aber unzulänglich, wenn sie den Einfluss von Ideologie und Religion, auf die sich solche Attentäter berufen, zu bagatellisieren versucht. Dass es zwischen Religionen grundlegende und prägende Unterschiede gibt (es gibt friedliche religiöse Botschaften mit Ermahnungen zur Nächstenliebe, zum Verzicht auf Gewalt - aber auch das Gegenteil, verbindliche Aufrufe zum kriegerischen Kampf, zur Vernichtung von Ungläubigen), sollte eine seriöse Analyse nicht verschweigen. Die Unterscheidung zwischen individueller Persönlichkeitsstruktur von Tätern und deren Beeinflussung durch Ideologien sollte nicht zur pauschalisierenden Verharmlosung, gar Verherrlichung totalitärer Gewaltdoktrinen führen.
Felix Feigenwinter, Basel
__________________________________________________________________________________________
Prostitution weiblicher Sexualität
Verpflanzen – wohin?
Von Felix Feigenwinter
Es gibt Themen, die scheinen sich für eine sachliche Auseinandersetzung schwer zu eignen. Das sogenannte „älteste Gewerbe“ gehört dazu. Es liegt gewissermassen in der Natur dieser Sache, dass oft, wenn davon gesprochen wird, frivole Belustigung, verlegene Abwehr oder dezidierte bis panische moralische Entrüstung um sich greifen. Kritisches Nachdenken scheint weniger gefragt. Gewiss, die Thematik um die Prostitution weiblicher Sexualität ist vielschichtig. Die Reaktionen reichen von der Behauptung sexueller und wirtschaftlicher Notwendigkeit über die Empörung wegen nächtlicher Ruhestörung bis zur moralischen Abscheu; manchmal kontrastieren sie mit romantischen Schwärmereien für das erotisch angereicherte gewisse Milieu, dem trotz knallharten Geschäftsgepflogenheiten Reiz und Charme abgewonnen wird. Nicht selten wird Neid gegenüber überdurchschnittlich gut verdienenden Sex-Gewerblerinnen spürbar, aber auch Empörung über dieses millionenfach praktizierte Geschäft, das jene provoziert, die bezahlte sexuelle Befriedigung für menschenunwürdig halten.
Dazu kommen die Zusammenhänge zu einem auf internationaler Ebene inszenierten Menschen-, sprich Kinder- und Frauenhandel nebst anderen kriminellen Verstrickungen. Der oft verdrängte, aber entscheidende Umstand der fehlenden gesellschaftlichen und beruflichen Alternative für allzu viele Mädchen und Frauen gerade aus armen Entwicklungsländern, die ihren Lebensunterhalt im reichen Europa als „Sexarbeiterinnen“ bestreiten, ist nicht zu übersehen. Solche Voraussetzungen der sozialen Not werden aber gern ignoriert, ebenso die Auswirkungen psychischen Elends. Darüber sollte die Existenz jener Frauen nicht hinwegtäuschen, die erklären, ihre Prostituiertentätigkeit freiwillig und unabhängig auszuüben und dabei viel Geld zu verdienen.
Nun wird am Rheinknie über die „Verpflanzung“ der in der Kleinbasler Altstadt stationierten Strassendirnen diskutiert. Barbarisch mutet es an, wenn - so wird gemunkelt – im Ernst erwogen wird, die betreffenden Damen „vor die Tore der Stadt“ abzuschieben, will sagen in das ungastliche Gebiet von St. Jakob an der Birs. Dort wäre zwar das „Anwohner-Problem“ gelöst (das Ruhe- und Ordnung-Bedürfnis der im „roten Viertel“ im Kleinbasel ansässigen Bevölkerung ist sehr verständlich und absolut legitim), doch würde man sogleich mit einem anderen Problem konfrontiert: Kenner der Szene erinnern daran, dass in Basel das Prostituierten-Milieu bisher in einem übersichtlichen und vergleichsweise „humanen“, geradezu idyllischen Rahmen gehalten werden konnte. Schon in Zürich beispielsweise präsentiere sich das entsprechende Milieu bedeutend rauer und krimineller – obschon auch Zürich nicht mit ausländischen Grosstädten verglichen werden könne. Dennoch wurde man in den letzten Jahren von Meldungen aus der Limmatstadt über Dirnenmorde aufgeschreckt. Basel blieb bisher davon verschont.
Eine Verpflanzung der Prostituierten an eine öde Strasse abseits der Behaglichkeit und Überschaubarkeit zivilisierten Stadtlebens würde eine Verwilderung und Brutalisierung dieses sich ohnehin am Rande gesellschaftlichen Lebens sich bewegenden Milieus bewirken. Ansätze zur Kultivierung des schwer kontrollierbaren Gewerbes würden zerstört. Im Interesse nicht nur der betroffenen Frauen sollte hier eine freundlichere Lösung angestrebt werden.
(Erschienen im „doppelstab“, Februar 1977)
Zwangsprostitution - menschenrechtswidrig
Kommentar von Felix Feigenwinter in der "TagesWoche" online als Reaktion auf die Reportage "Das andere rote Basel" vom 29. November 2013:
Menschenrechtlich argumentierende Ethiker und Feministinnen definieren Prostitution als Leibeigenschaft auf Zeit, Zwangsprostitution als legitimierte Vergewaltigung. Gegner eines generellen Prostitutions-Verbots bemühen "Freiheitsrechte" von Freiern und Dirnen oder Sorge um die Prostituierten, die dann noch leichter Opfer von Ausbeutung würden. Wieder andere wollen Bordelle verstaatlichen. Dagegen wurde im sozialistischen Cuba die Prostitution nach der Revolution offiziell verboten.
Bei aller Widersprüchlichkeit solcher Ansichten: In jeder zivilisierten Gesellschaft müssten die Ächtung von Zwangsprostitution und die strafrechtliche Verfolgung des kriminellen Mädchen- und Frauenhandels sowie staatliche (oder privat organisierte institutionelle) Aussteigehilfe selbstverständlich sein.
Felix Feigenwinter
________________________________________________________________________________
Sexueller Missbrauch von Kindern
Unbewältigtes Kapitel pervertierter Emanzipation
„Wir haben böse Eltern“, Tages Anzeiger vom 20.11.2010
Diese skandalöse, traurige und unappetitliche Familiengeschichte enthüllt die düstere Kehrseite der von Vertretern der 68er-Bewegung infantil und heuchlerisch idealisierten sogenannten sexuellen Befreiung. Der sexuelle Missbrauch von Kindern durch gewissenlose egoistische Erwachsene wurde verharmlost. Dass im geschilderten Fall sowohl der Haupttäter als auch dessen Komplizinnen strafrechtlich offenbar nie zur Rechenschaft gezogen wurden, passt ins Bild. Umso verdienstvoller ist die „Aufarbeitung“ dieses unbewältigten Kapitels pervertierter „Emanzipation“ - dieses Rückfalls in finsterste Barbarei im Namen einer puerilen Befreiungsideologie.
Felix Feigenwinter, Basel
(Erschienen im TagesAnzeiger vom 23. Nov. 2010)
Fürs ganze Leben geschädigt
Betr. Psychologin Susan Clyncy zum Missbrauch von Minderjährigen
SonntagsZeitung vom 27.6.2010
Sexueller Missbrauch von Kindern durch katholische Priester erregt mehr Aufsehen als jener durch „gewöhnliche“ Täter, weil dieses verabscheuungswürdige Verbrechen, wenn es von geweihten Männern einer sexualmoralpredigenden Organisation begangen wird, besonders provozierend ist.
Dass ausgerechnet als „kultfähig“ Geweihte (ausschliesslich männlichen Geschlechts) einer sich als „unfehlbar“ und „heilig“ präsentierenden autoritären Institution und Verwalterin tradierter Religiosität reihenweise als Kinderschänder entlarvt wurden, entfacht natürlich einen Sturm von Reaktionen.
Sogenannte Seelsorger, die den ihnen anvertrauten Kindern schwere seelische Schäden zufügen, sollen nicht mehr geduldet werden, heisst es. Das Leiden der für ihr ganzes Leben geschädigten Opfer bleibt trotzdem weitgehend unverstanden.
Felix Feigenwinter, Basel
Ideologie diente als schäbiges Alibi
Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der „Basler Zeitung“ vom 18. April 2017 als Antwort auf den Artikel „Opfer als Täter und Täter als Opfer“ von René Zeyer in der BaZ vom 10.4.2017.
René Zeyers kritische Gedanken zur Veröffentlichung des Buches von Markus Zangger ändern nichts an der Problematik eines Phänomens, das der öffentlichen Klärung bedarf. Auch wenn sich Prominente aus dem linken Lager wie alt Bundesrat Leuenberger dagegen sträuben, eine ganze politische Generation als Mittäter zu vereinnahmen, so bleibt die trübe Erinnerung an eine blauäugige, infantile oder/und heuchlerische Befreiungsideologie, welche verantwortungslosen sogenannten Pädagogen für deren sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche als schäbiges Alibi diente.
Felix Feigenwinter, Basel
___________________________________________________________________________________
Zuwanderung
Im Jahr 1974 erschien im “doppelstab” ein persönlich geprägter Kommentar von Felix Feigenwinter zum damals auch unter den Begriffen “Überfremdung” und “Übervölkerung” diskutierten Thema Einwanderung. Dieser Text aus dem letzten Jahrhundert endet mit einem Blick in die Zukunft; auch über vierzig Jahre danach erscheint er aktuell, mit steigender Dringlichkeit. Europaweit und interkontinental drängen dramatische Migrationsprobleme zu umstrittenen Lösungen…
Wege zur Überfremdung
Von Felix Feigenwinter
Bereits im späten Mittelalter waren Angehörige der Familie meines Vaters, deren Namen ich trage, nachweisbar auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft ansässig, und der aus Leipzig zugewanderte Ahne der Familie meiner Mutter erwarb 1524, also auch schon vor einigen hundert Jahren, das Basler Bürgerrecht. Im Blick auf diese Stammbäume hätte also kaum jemand Grund, an meiner „Zugehörigkeit zur Schweiz“ zu zweifeln. Freilich ist mein Bürgerrecht natürlich nicht mein eigenes Verdienst – sondern u. a. jenes einiger Einwanderer vor etlichen hundert Jahren, und deshalb erfüllt es mich auch nicht mit Selbstgerechtigkeit, sondern höchstens mit persönlicher Beruhigung über die Rechte, die für mich damit verbunden sind. Anderseits kann ich mich des Unbehagens nicht erwehren, dass viele andere Individuen, die solche Rechte ebenfalls benötigen, darauf verzichten müssen. Diese Einsicht mag zwar so etwas wie private Dankbarkeit aufkommen lassen – aber noch viel stärker weckt sie das Bedürfnis, die Differenzen im Rahmen des politisch Möglichen und Sinnvollen auszugleichen. Sicher, das hat nicht allein mit Altruismus, sondern auch mit nacktem Überlebensinstinkt zu tun: Nüchtern gestanden kann ich es mir einfach nicht vorstellen, wie die weltweiten ökologischen und ökonomischen (Überlebens-)Probleme, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht nur auf die reiche „Puppenstube Schweiz“, sondern auf die gesamte Menschheit zukommen, ohne ein Minimum an Verständigung zwischen allen, die zur Spezies Mensch gehören, gelöst werden sollen.
Wenn ich zuweilen so etwas wie Befriedigung über mein Bürgerrecht verspüre, so stets dann, wenn ich mich mit der Schweiz als Quell und Hort humanitärer Ideen und völkerverständigender Institutionen zu identifizieren vermag. In dieser Beziehung spricht mich das weiße Kreuz im roten Feld an. Dass die (sogenannten Übervölkerungs-)Probleme, welche viele Bewohner unseres Landes gegenwärtig vor allem beschäftigen, keineswegs von Pappe sind, wird wohl niemand, der Anspruch auf Ernsthaftigkeit erhebt, bestreiten. Alle Lösungen, die von besonnenen Bürgerinnen und Bürgern als Alternative zu den NA-Forderungen entwickelt worden sind, verdienen größte Beachtung.
Allerdings wäre es naiv, zu glauben, unser kleines, rohstoffarmes Land könne den in den vergangenen Jahrzehnten erarbeiteten Wohlstand mit all den beachtlichen zivilisatorischen (politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen) Errungenschaften unbeschränkt und problemlos mit der grossen, weiten Welt teilen... Eine sich immer mehr abzeichnende allumfassende, uns unabwendbar herausfordernde Globalisierung mit unabsehbaren, schwer steuerbaren Emigrationsströmen verlangt umsichtige, intelligente Vorkehrungen - und bei aller geschmeidiger Weltoffenheit auch den Mut zu selbstbewussten eigenständigen Lösungen. Die Idee, dass sich die (Dritte) Welt "verschweizert", ist eine heitere Zukunftsvision, aber die Schreckensprognose, wonach umgekehrt die Schweiz irgendwann zum Entwicklungsland verkommen könnte, sollte auch nicht ganz ausser acht gelassen werden.
(Geschrieben 1974)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In den Jahren 1971-73 wirkte Felix Feigenwinter als Alleinredaktor der "Freiämter Zeitung" in Wohlen (Kanton Aargau). Als er im Juli 1973 nach Basel in die "doppelstab"-Redaktion zurückkehrte, verabschiedete er sich von der aargauischen Leserschaft:

___________________________________________
DAS HARTNÄCKIGE VORURTEIL IST WIDERLEGT / Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 12. Dezember 2014 in der "Basler Zeitung", als Antwort auf den Text "Wes Brot ich ess" von Stefan Zemp in der BaZ vom 5.12.14:
Beim Lesen von Stefan Zemps BaZ-Schelte frage ich mich, wieso seine Meinungsäusserung ausgerechnet in der Basler Zeitung erscheint, also in der Zeitung, die angeblich seit der ökonomischen Rettung durch den gern geschmähten Christoph Blocher nach Zemps Ansicht "Andersdenkende mit einem Denkverbot belegt".
Das schon von den "Rettet Basel"-Aktivisten gebetsmühlenartig verbreitete Vorurteil, die neue Basler Zeitung würde doch die demokratische Meinungsvielfalt beeinträchtigen, wird tagtäglich durch das Publizieren unterschiedlichster Ansichten in Kolumnen, Leserbriefen etc. widerlegt. Die vielen historisch reflektierten Artikel von Chefredaktor Markus Somm zu den aktuellen politischen Themen provozieren auch Widerspruch (der in der BaZ nicht unterschlagen wird), bereichern aber auch die demokratische Debatte und beflügeln die intellektuelle Auseinandersetzung. Es muss nicht immer der linke Einheitsbrei sein. Felix Feigenwinter, Basel
WER INSTRUMENTALISIERT WAS UND WOZU? / Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 19. Januar 2015 in der "Basler Zeitung", als Reaktion auf den Text "Kleiner Charlie ganz gross" in der BaZ vom 15.1.15:
So phänomenal die vom internationalen politischen und religionsrepräsentierenden Establishment begleiteten Massenkundgebungen gegen das Blutbad in der Redaktion von Charlie Hebdo auch waren, dem einhellig verkündeten "Je suis Charlie" ist nicht zu trauen. Waren es nicht dieselben Kreise, die sich aktuell im Auftrieb der Massen in mainstreamiger Eintracht angeblich so sehr für unbegrenzte Meinungsfreiheit einsetzen, die vor noch nicht langer Zeit gegenüber den Schöpfern der allseits als "mittelmässig" geschmähten dänischen Mohammed-Karikaturen jede Solidarität vermissen liessen? Im gleichen Atemzug, mit denen sie heute "Je suis Charlie" skandieren zugunsten einer angeblich hoch geschätzten Meinungsfreiheit (inklusive Religionskritik), diskreditieren sie andere Demonstranten, die von eben diesem demokratischen Recht Gebrauch machen, und werfen diesen ausgerechnet "Instrumentalisierung" und "Missbrauch der Meinungsfreiheit" vor. Felix Feigenwinter, Basel
MEINUNGSAUSTAUSCH OHNE IDEOLOGISCHE SCHEUKLAPPEN / Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 11. März 2015 in der "Basler Zeitung", als Reaktion auf das Interview mit Christoph Blocher in der BaZ vom 2.3.15 und die Replik von Elisio Macamo in der BaZ vom 9.2.15:
Im BaZ-Interview erschien Christoph Blocher als fast grenzenlos neugierige, kreative und risikofreudige Persönlichkeit, die vorurteilslos und ohne Berührungsängste in der grossen weiten Welt agiert und ihre Erfahrungen mit fremden Menschen und Mentalitäten originell zu interpretieren wagt. In seiner Replik erwidert Professor Elisio Macamo aus kompetenter afrikanischer Sicht und mit geistreicher Eloquenz das Gespräch mit dem Unternehmer, Entwicklungshelfer (ja, auch das) und aufsässig-provokanten Politiker, ohne dabei dem verbreiteten dümmlichen "Anti-Blocher-Reflex" zu verfallen. Ich habe beides mit Vergnügen und Erkenntnisgewinn gelesen. So wünschte ich mir die Auseinandersetzung auch anderswo: freier Meinungsaustausch ohne ideologische Scheuklappen. Felix Feigenwinter, Basel.
Kein Friede ohne Demokratie / Leserbrief von Felix Feigenwinter als Reaktion auf Helmut Hubachers Kolumne "Wären wir ohne EU real besser dran?" in der "Basler Zeitung" vom 9. Juli 2016:
Kriege werden meist von Diktatoren angezettelt, nicht von Demokratien. Der Glaube an eine friedenssichernde EU, mit ihren heute eklatanten Demokratiedefiziten und dem offen zugegebenen Demokratieargwohn seiner reformunwilligen Exponenten, sollte den Blick auf den aktuellen Zustand dieses bürokratischen Konstrukts nicht verschleiern. (Friedenssichernd war übrigens primär die NATO!) Bemerkenswert, wenn ausgerechnet Sozialdemokraten (die doch für soziale Sicherheit kämpften) Warnungen wie die von Baberowski ignorieren:
«Der Sozialstaat kann nicht überleben, wenn die ganze Welt eingeladen ist, sich zu nehmen, was andere hart erarbeitert haben. Die nationalstaatliche Souveränität ist ein kostbares Gut, das die Freiheit sichert.»
Statt die Gefährdung der in Jahrzehnten geschaffenen gut funktionierenden Sozialwerke zu verhindern, wird die EU-betriebene Zersetzung demokratisch-föderalistischer Strukturen und nationaler kultureller Identitäten hingenommen. Müsste ein Europäer, der in einer direkten Demokratie basisdemokratisch sozialisiert wurde, der Entwicklung zu einem in Brüssel zentralverwalteten (und von Berlin aus diktierten?) europäischen Einheitsstaat nicht wache Skepsis statt blauäugiges Wohlwollen entgegenbringen? Felix Feigenwinter, Basel
Sprach die Kaiserin von Europa?
Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der “Basler Zeitung” am 28. Juli 2016, als Reaktion auf die Kolumne von Regula Stämpfli “Wir schaffen das, oder?” in der BaZ vom 26.7.16:
Regula Stämpflis Generalabrechnung mit Angela Merkels alternativloser “Wir schaffen das”-Politik beeindruckt; sogar der SP-Vize-Kanzler Gabriel kriegt sein Fett weg. Die Beurteilung, der Satz “Wir schaffen das!” hebe sich von den sonst sinnentleerten Worthülsen der CDU-Kanzlerin erstaunlich deutlich ab, ist besonders brisant.
Aber wie eindeutig ist dieses “Wir”? Wer ist damit gemeint? Die deutsche Bundeskanzlerin schloss in letzter Konsequenz (demokratisch nicht legitimiert!) alle von ihrer Politik betroffenen Europäer mit ein (letztlich auch die Nicht-EU-Schweizer…). Sprach da die Kaiserin von Europa?
Zu bedenken gilt, dass Angela Merkel in einer kommunistischen Diktatur sozialisiert worden ist. Als Widerstandskämpferin gegen das DDR-Regime vor dem Mauerfall ist die Pfarrerstochter und junge Physikerin aus Templin nie aufgefallen (um es milde zu formulieren). Offenbar verloren sich ihre herkunftsbedingten Wir-Vorstellungen nach aufgezwungener Auflösung der DDR-Identität ins Grenzenlose.
__________________________________________________________________________________________
REHABILITIERUNG EINES RELIGIONSVERFOLGTEN
Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 4. November 2015 in der „Basler Zeitung“ als Reaktion auf den Artikel „Basler Reformator“ erhält ein Gesicht (in BaZ 28.10.15).
Die umfassende, mit einem eindrücklichen Bild illustrierte Würdigung von Sebastian Castellio im Zusammenhang mit einer Biografie-Besprechung betrachte ich als eine späte Rehabilitierung dieses wegen seiner Schriften im reformierten Basel des 16. Jahrhunderts diskriminierten Calvin-Kritikers. Dessen ehrendes Andenken wurde bisher vernachlässigt in der Humanistenstadt Basel, wo Castellio von 1544 bis zu seinem Tod 1563 lebte und trotz Verfolgung und Diffamierung als mutiger Frühaufklärer wirkte. Im peripheren Stadtteil St. Alban gibt es zwar ein verborgenes Castellio-Weglein, dessen Abgeschiedenheit mir aber symptomatisch erscheint für den bisher verkannten Stellenwert dieses bedeutenden Humanisten aus Basel, der übrigens auch mit dem posthum verbrannten „Ketzer“ David Joris befreundet war.
Felix Feigenwinter, Basel
Ein in der Humanistenstadt verkannter Humanist
Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen in der "Basler Zeitung" am 8. November 2016 unter dem Titel "Ehre auch von offizieller Seite", als Reaktion auf den Artikel "Im Namen religiöser Toleranz" in der BaZ vom 4.11.16:
Die längst fällige Rehabilitierung des während seines Lebens und Wirkens in Basel diffamierten, verfolgten und auch nach seinem Tod Jahrhunderte lang fahrlässig bis vorsätzlich missachteten Humanisten Sebastian Castellio ist der privaten Initiative einiger engagierter Idealisten und Gönner zu verdanken. Es wäre an der Zeit, dass sich nun endlich auch das „offizielle Basel“ (die Regierung, die Universität, die Denkmalpflege der Humanistenstadt) um ein angemessenes würdiges Andenken bemüht, sei es durch die Wiederherstellung der aus dem Kreuzgang des Münsters entfernten Grabtafel oder zum Beispiel die Namensgebung eines Universitätsinstituts.
Castellios Botschaft ist auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts von brennender Aktualität – in einer Zeit, in welcher mörderische Bedrohung von Ungläubigen sowie Verfolgung/Kriminalisierung von Meinungsgegnern wieder toleriert und der Protest gegen den Religionsterror als Intoleranz desavouiert wird.
Felix Feigenwinter, Basel

GEDENKTAFEL FÜR SEBASTIAN CASTELLIO – Schreiben von Felix Feigenwinter an Herrn Dr. Bernhard Vischer, Stansstad:
Lieber, sehr geehrter Herr Dr. Vischer,
__________________________________________________________________________________________

Kurioser Schnappschuss aus dem Jahr 2001:


Felix Feigenwinter im Fextal
______________________
Hans A. Jenny über die Geschichte des “doppelstab” und dessen langjährigen Mitarbeiter Felix Feigenwinter:
In seinem 85. Lebensjahr, in dem der frühere (und erste) “doppelstab”-Chefredaktor Hans A. Jenny vom Regierungspräsidenten des Kantons Basel-Landschaft, Thomas Weber, am 15. September 2016 in der Kantonsbibliothek in Liestal für “langjähriges Schaffen als Sammler, Kulturvermittler, Autor und Herausgeber” geehrt wurde, verfasste Jenny einen Text über die Geschichte der Gratiszeitung “doppelstab”, in dem er seinen einstigen Redaktionskollegen Felix Feigenwinter und dessen langjähriges Wirken beim “doppelstab” in den Neunzehnhundertsechziger- und Neunzehnhundertsiebzigerjahren mit folgenden Worten charakterisierte und würdigte:
“Ein besonders wertvoller Mitarbeiter war der stilsichere und in seinen Kolumnen und Glossen Alltags-Situationen brillant schildernde und alle Charaktere perfekt zeichnende Schriftsteller Felix Feigenwinter, der wenige Jahre später auch unser Redaktionskollegium bereicherte. In seiner unverwechselbaren Originalität passte er ausgezeichnet in unser munteres Team.”
(Eine gekürzte – von BaZ-Redaktor Christian Keller redigierte – Fassung von Jennys Erinnerungsschrift erschien am 15.9.16 unter dem Titel “Die Doppelstab-Story” in der “Basler Zeitung”.)
---------------------------------------------------------------
Unten: F.F. im Garten des Restaurants Au Violon in Basel
Mein Wirken als Journalist unterschied sich von jenem als Schriftsteller wesentlich: Hatte ich als Journalist vor allem über das öffentliche Leben zu berichten und Prominente zu interviewen, also die “offizielle Wirklichkeit” darzustellen – notfalls auch kritisch zu hinterfragen, das freilich schon – , so (unter)suchte ich als freier, nur mir selber Rechenschaft schuldiger Geschichtenschreiber Verborgenes und unterwanderte konventionelle Grenzen. Statt “Offizielles” zur Geltung zu bringen, versenkte ich mich als Autor in seelische Abgründe, in individuelle Befindlichkeiten scheinbar gewöhnlicher Privatmenschen, mit Vorliebe für Aussenseiter und Sonderlinge. Dabei erschuf ich Imaginäres – eine kreative Herausforderung, die dem strikt realitätsbezogenen Journalismus fremd ist. – Meine Intention, mich Sonderlingen zuzuwenden, sie als Individuen zu erfassen und zu würdigen, gründete in einer philosophischen, sozusagen anthropologischen Betrachtungsweise. – Den Wert des Individuums suche und sehe ich jenseits opportunistischer Bewertungsklischees. F.F.
GESCHICHTEN VON SONDERLINGEN:
http://feigenwinter.wordpress.com
GESCHICHTEN VOM TOTENTANZ:
http://felixfeigenwinterautor.wordpress.com
SKURRILE GESCHICHTEN:
https://feigenwintergeschichten.wordpress.com/
KRIMINALGESCHICHTEN:
http://feigenwinterkriminalstories.wordpress.com
ERZÄHLUNG Schwelle zum Paradies:
http://schwellezumparadies.wordpress.com
_______________________________________________________________________________________
Von Liechtenhayn über Liechtenhan bis zu Lichtenhahn
PERSÖNLICHES, FAMILIÄRES
Am 14. Dezember 2016, an seinem 77. Geburtstag, verschickte Felix Feigenwinter an seine nächsten Verwandten einen "Geburtstagsbrief", in dem er Gedanken und Assoziationen äusserte zu persönlichen Erinnerungen und zur Geschichte der Familie Lichtenhahn, der Stadtbasler Sippe der Mutter Elisabeth Feigenwinter-Lichtenhahn:
Der Blick auf drei Bilder aus dem Nachlass der Herkunftsfamilie Lichtenhahn unserer Mutter lassen mich in die Welt meiner Ahnen mütterlicherseits versinken, ins alte Basel. Diese Bilder schmückten Jahrzehnte lang die Wohnungswände unserer Familie Feigenwinter in Liestal, bis sie im Zusammenhang mit dem Umzug unserer Eltern von der Rotackerstrasse ins Oberwiler Altersheim an ihren "Geburtsort" Basel zurückkehrten - sehr zu meiner Freude, denn seither kann ich sie wieder täglich betrachten. Das eine des Trio, ein kleines Ölgemälde, ist im Jahr 1844 von Mamme's Urgrossvater Emanuel Friedrich Lichtenhahn (Liechtenhan) gemalt worden, der von 1817 bis 1894 lebte. Dieser (Freizeit-)Künstler wohnte in der Basler Altstadt bei der Peterskirche (das benachbarte Petersschulhaus, wo unser Daniel als Primarschüler ein- und ausging, war damals noch nicht gebaut...). Das erwähnte Bildchen, ein Stilleben mit traditionellem Motiv (ich würde es mit dem Titel "Vergänglichkeit" versehen) zeigt ein massives Holzbrett, auf welchem verschiedene symbolträchtige Gegenstände versammelt sind: eine Kerze, deren Docht glimmt, ein Musik-Zupfinstrument, ein menschlicher Totenkopf, ein dickes Buch (wahrscheinlich eine Bibel), zwei Uhren (eine Sanduhr und ein Taschenührchen), eine Vogelfeder, eine Muschel, eine Vase mit einem Blumenstrauss, der von einem Schmetterling oder Falter umschwirrt wird. Ausserdem ein Blatt Papier (oder ein Tüchlein), auf dem zu lesen steht:
Der Tod ist gewiss, ungewiss
der Tag.
Die Stund auch niemand
wissen mag.
Der selbe (Freizeit-)Künstler, Mamme's Urgrossvater, also mein/unser Ururgrossvater, schuf auch das andere Stilleben, das schöne, grosse, dunkle, warme Ölgemälde aus dem lichtenhahn'schen Nachlass. Darauf zu sehen ist kein Totenkopf, aber wieder dieses dicke Buch, jetzt aufgeschlagen, darauf liegt eine Lesebrille, ausserdem stehen auf der mit einem schmucken Tischtuch bedeckten Tischplatte eine Kaffeetasse und ein Kaffeekännchen, ein Brotlaib liegt auch da samt Brotmesser, und im Hintergrund steht ein Nähkorb mit einer "Schtriggede" drin. Ein sympathischer Einblick in den lichtenhahn'schen Haushalt, vor bald zweihundert Jahren, gemalt mit liebevoller Sorgfalt, feinem handwerklichem Geschick, künstlerischer Sensibilität und Kulturbewusstein; im Unterschied zum kleinen Stilleben aus dem Jahr 1844 fehlt leider die Angabe des Entstehungsjahres.
Beim dritten Bild handelt es sich offensichtlich nicht um ein Werk des Ururgrossvaters, sondern um eine kolorierte hübsche Zeichnung, welche Angehörige der Familie Lichtenhahn in ihrer Wohnung gemütlich am Esstisch sitzend zeigt; datiert ist die Zeichnung mit der Jahreszahl 1837, daneben die Initialen AB. Spekulationen über den Namen des Zeichners/der Zeichnerin sind Tür und Tor geöffnet.
Alle drei Bilder verführen jedenfalls zu einer andächtigen und inspirierenden Zeitreise in die Welt der Ahnen aus der Herkunftsfamilie unserer Mamme Elisabeth Lichtenhahn.
***

Der Stammvater aller Basler mit Namen Lichtenhahn (oder Liechtenhan oder Lichtenhan) war Ludwig Liechtenhain (1504-1558), der in der Reformationszeit und kurz nach dem Tod seines Vaters als junger Eisenhändler von Leipzig nach Basel auswanderte, wo er sich offenbar - sowohl als Anhänger des neuen reformierten Glaubens, als auch beruflich - günstige Lebensbedingungen erhoffte. Zu Recht: Schon 1524 wurde er Basler Bürger (im gleichen Jahr heiratete er Elisabeth Pur, eine Tochter des Schultheissen Rudolf Pur von Aarau - dieser Ehe entsprangen vier Kinder; vier weitere entsprossen der zweiten Ehe mit Ursula Heydelin, der Tochter des Oberzunftmeisters Marx Heydelin von Basel), womit die Geschichte einer neuen Stadtbasler Sippe lanciert war, die heute noch im Kreuzgang des Basler Münsters mit einem stattlichen Familiengrab-Denkmal (grosse steinerne Grabplatte) repräsentiert wird. Der dort auf dem Familienwappen dargestellte Hahn kann allerdings hinterfragt werden, weil Lichtenhahn ja ursprünglich Liechtenhain hiess. Diese ursprüngliche Bedeutung wird im Lichtenhahn-Wappen sichtbar, denn da ist auch ein Hain (Bäume) abgebildet. Der Hahn ist ein gern verwendetes Wappentier, als Symbol von Wachsamkeit, Kampfbereitschaft, Verkündung des Tages. Im Lichtenhahn-Wappen trägt er zwei brennende Fackeln im Schnabel, wird also zum Lichtträger, zum lichten Hahn...
Das h im Namen hat meinen Ururgrossvater, dem ich die in meiner kleinen privaten Bildersammlung hängenden Stilleben verdanke, gestört: Seinen Geschlechtsnamen liess er amtlich bestätigt in "Liechtenhan" (mit ie, aber ohne h) umwandeln, womit freilich einer seiner Söhne, der Primarlehrer Karl Heinrich Lichtenhahn, nicht einverstanden war, weshalb dieser die Namensänderung für seine Person und seine direkten Familienangehörigen wieder rückgängig machen liess...
Doch einige Jahrzehnte später, in den Neunzehnhundertdreissigerjahren, beantragte ein anderer Nachkomme, Richard Lichtenhahn, nicht nur die Verwandlung seines Familiennamens zu "Lichtenhan" (ohne ie und ohne h), sondern auch jene seines Vornamens Richard - diesen wünschte er durch "Lucas" zu ersetzen, wie ein Regierungsratsbeschluss vom Mai 1936 festhielt. Da dies in der Zeit des im Nachbarland bedrohlich herrschenden Hitler-Regimes geschah, vermute ich, dass dem eigensinnigen und feinsinnigen Kunstfreund, der als Kurator der Basler Kunsthalle Lucas Lichtenhan in den Neunzehnhundertvierzigerjahren öffentliches Ansehen erwarb, der Taufname Richard einfach zu "deutsch" war, weshalb er ihn mit dem aparten Vornamen "Lucas" eintauschte.
So ist es gekommen, dass die Basler Nachkommen der im Mittelalter in Jüterbog (Brandenburg) sowie Leipzig und Jena nachgewiesenen Geschlechts der Liechtenhain (auch Lichtenhayn oder Liechtenhayn) unterschiedlich heissen. Aber ob sie sich nun Lichtenhahn, Liechtenhan oder Lichtenhan nennen - alle diese Basler sind miteinander blutsverwandt, stammen alle von Ludwig Liechtenhain ab.
Die Basler Lichtenhahn sind seit Anfang eine protestantisch geprägte Sippe, in deren Reihen nicht zufällig reformierte Theologen auftauchen, so die Pfarrherren Bonifacius Lichtenhan (1625-1671), Pfarrer von Bretzwil, Reigoldswil und Lauwil; Hans Rudolf Lichtenhahn (1731-1805), Pfarrer von Buus und Maisprach; Hans-Heinrich Liechtenhan-Riedtmann (1729-1811), Pfarrer in Kleinhüningen; Johann (Hans) Benedict Lichtenhahn (1847-1903), Pfarrer der Theodorgemeinde in Basel sowie Professor Johann Rudolf Lichtenhahn (1875-1947), Pfarrer der Basler Matthäusgemeinde. Eine besondere Aufgabe übernahm Friedrich Lichtenhahn-Stehelin (1806-1866): nach seiner Tätigkeit als Pfarrer von Rothenfluh wurde er in seiner Heimatstadt "Waisenvater", das heisst Leiter des Basler Waisenhauses. Und international (wohl-)tätig war August Fritz Lichtenhahn (1871-1947), gewürdigt mit dem Ehrendoktor der theologischen Fakultät der Universität Wien und Mitbegründer sowie erster Sekretär des schweizerischen Volksbundes.
Der Vater unserer Mutter, Adolf Lichtenhahn (1882-1940), brach mit der protestantischen Familientradition, indem er eine Katholikin aus dem Elsass heiratete: unsere Grossmutter Felicita Gottenkieni, genannt Elise (1879-1961), eine bei uns Enkelkindern sehr beliebte, weil phantasievolle Grossmutter, die ihre katholische Heiligenverehrung nicht verbarg, indem sie uns die Amulette zeigte, die sie unter ihrer Bluse trug, und die uns abenteuerliche Geschichten von grünen Marsmenschen erzählte, die sie als Kind im Elsass habe landen sehen. Und die Tochter, unsere Mutter Elisabeth Lichtenhahn, festigte den Kulturbruch, indem sie einen waschechten, lupenreinen Katholiken aus dem basellandschaftlichen Birseck ehelichte: Georg Feigenwinter, unseren Vater.
Felix Feigenwinter, 14. Dezember 2016.
(Quelle: "Die Chronik derer zu Lichtenhahn" von René Falconnier, 1979)
____
Die Familie Feigenwinter-Lichtenhahn in Liestal
Der Vater Dr. Georg Feigenwinter, damals Obergerichtsschreiber und später Strafgerichtspräsident, und die Mutter Elisabeth, geborene Lichtenhahn, mit ihren vier Kindern vor dem gelben Einfamilienhaus an der Ergolz in Liestal.
Das Familienporträt entstand in den Neunzehnhundertvierzigerjahren, nach dem Ende des zweiten Weltkriegs (während dem der Vater in der Schweizer Armee als Oberleutnant diente). Auf dem Foto hält die Mutter das jüngste Kind, Beat, den späteren Juristen, auf dem Arm. Im Mittelpunkt steht die mit einem Blumen-Haarkranz geschmückte Adelheid, die spätere Schriftstellerin und Malerin, im weissen langen Festkleid des Erstkommunion-Kindes. Daneben links die jüngere Schwester Theres, rechts der Bruder Felix.
_______________________________________________________
Der Journalist als Clown und König…
Die Tätigkeit in der “doppelstab“-Redaktion beschränkte sich nicht auf journalistische Arbeit. Von Zeit zu Zeit organisierte die Zeitung für die Leser spezielle Veranstaltungen, zum Beispiel im Hochsommer ein “Badehosen-Festival” (mit Wettbewerb “Wer trägt das originellste Badekleid?”), eine Olympiade für sportliche Jugendliche nebst Kindernachmittage mit Kasperlitheater, Märchenstunde, Auftritten von Tierdompteuren und Zauberern. “doppelstab”-Journalisten verkleideten sich, traten auf als Napoleon, Clown, König, Prinzessin… Bild oben: Der Chefredaktor Hans Jenny in einer historischen (Theater-)Militäruniform aus der Zeit Napoleons (rechts) und “Clown” Felix Feigenwinter geleiten die Teilnehmer eines der legendären “doppelstab”-Kinderfeste durchs Spalentor.

Oben: Hinter dem Kollegiengebäude der Universität Basel beim Petersplatz verfolgen die Kinder vergnügt den Sprung von Clown Felix Feigenwinter ins Brunnenwasser.
Unten: Anlässlich eines anderen Kinderfestes trat Felix Feigenwinter als “Märchenkönig” auf, mit “Prinzessin” Hannah Mangold am Arm.
__________________________________________________________
WITZIGE ANTWORT
E-Mail-Kommunikation zwischen zwei Schreibern aus dem selben Geburtsjahr (1939):
Gesendet: Samstag, 17. Dezember 2016 13:08
An: Prof. Francois Fricker *
Betreff: Dein Text in der heutigen Basler Zeitung
Lieber François,
Welche Überraschung: François Fricker als Analytiker amerikanischer Wahlregeln! Wird da die Karriere eines neuen hochkarätigen aussenpolitischen BaZ-Journalisten lanciert?... Dass ich Deinen offenbar auch mathematisch inspirierten Gedanken nur beschränkt folgen kann, scheint mir nur logisch; als Gelegenheitsschreiber von Leserbriefen befinde ich mich längst auf dem Rückzug. In diesem Zusammenhang wiederhole ich meine schon früher formulierte Feststellung:
In der Zeitspanne, während Du Dich verjüngtest, wurde aus mir ein gefühlter Greis.
Mit grosser Bewunderung und einem herzlichen Gruss
Felix Feigenwinter
Lieber Felix,
irgendwie bist Du mir mit Deiner Post zuvorkommen, wollte ich Dir doch schon lange meine Freude über unsere vergangene Zusammenkunft ausdrücken und hoffen, dass sich so etwas gelegentlich wiederholen wird.
Und was Deine schmeichelhafte Bemerkung betrifft, so nehme ich diese mit Vergnügen entgegen. Aber ich gebe mir grosse Mühe, mich nicht weiter zu verjüngen, damit Du Dich nicht noch weiter vergreist fühlst.
In diesem Sinne und mit einem herzlichen Gruss,
François
*Professor François Fricker (Jahrgang 1939) war in jungen Jahren Lehrer am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium (MNG) in Basel, später - während 30 Jahren (von 1973 bis 2003) - Professor für Mathematik an der Justus-Liebig-Universität in Giessen. Für Schweizer Zeitungen schrieb er viele kulturhistorische Texte. In seinem Wohnort Basel kennt man ihn auch als Zauberkünstler.
_____________________
GEDANKEN ZUM LEBEN, GLAUBEN und STERBEN
(Tagebuch-Eintragungen im Februar 2017)
Väterlichem Erziehungsprogramm verdanke ich frühe katholische Sozialisierung, auch den Zugang zur katholischen Mystik, der reformierten Herkunft meiner Mutter protestantisches Kulturverständnis, auch den Sinn für individuellen Widerstandgeist, für nonkonformistischen Eigensinn, trotz bürgerlich-konventionellem Hintergrund.
Religionen betrachte ich wohlwollend, wenn sie friedlich und menschenfreundlich seelsorgerische und soziale Hilfe, Trost und Hoffnung anbieten. Skeptisch beurteile ich ich totalitäre, repressive, gar gewaltträchtige theologische Ideologien - besonders, wenn diese machtpolitisch allgemeingültig "verwirklicht" werden sollen. (Religiöse Werte als staatliche Richtlinien festzulegen, halte ich grundsätzlich für problematisch: freiheitliche, auch von der Aufklärung geprägte Demokratien könnten leicht in autoritäre "Gottesstaaten" verwandelt werden.)
Religiöser Glaube, Spiritualität als Ausdruck und Erfüllung der Sehnsucht nach kosmischer Verbindung, nach "Ewigkeit", ist für mich eine private Angelegenheit. Meditation, introvertierte Versenkung, entzieht sich gesellschaftlicher Kontrolle.
Auch das Sterben ist ein persönliches, eigentlich einsames Erlebnis; ein natürliches Ereignis - allerdings nicht unabhängig vom sozialen zivilisatorischen Netz, welches das Leben gefangen hielt.
Felix Feigenwinter, im Februar 2017
_____________________________________________
BARBARA FREY ERINNERT AN ADELHEID DUVANEL
Ergreifende Kunde aus Zürich: Im Zentrum Karl der Grosse erinnert die Germanistin und Theaterregisseurin Barbara Frey in einer tiefgründigen Winterrede an ein öffentlich schon fast vergessenes besonderes Stück Schweizer Literatur aus dem letzten Jahrhundert: an die Poesie meiner Schwester Adelheid Duvanel-Feigenwinter. Die langjährige Intendantin am Schauspielhaus Zürich lässt, verwoben mit eigenwilligen und einleuchtenden Assoziationen, Texte meiner 1996 verstorbenen Schwester aufleben. Aus Barbara Freys Rede zitiere ich: „Auf eine Weise ist Duvanel auch eine Geisterseherin. Aber keine esoterische oder vernebelte, sondern eine seltsam nüchterne, lakonische, die sich nicht wundert über die unverrückbare Nähe von Wachzustand und Tiefschlaf, von Vernunft und reiner Phantasie, von Alltagsmensch und Traumgestalt.“
Erinnerungschwere Worte im Januar 2019.
Felix Feigenwinter
_______________________________________________________
Wiedererweckung des literarischen Werks von Adelheid Duvanel
im Limmat Verlag
Ein Lichtblick in der verrückten, traurigen und schaurigen Zeit der Corona-Pandemie:
Der Limmat Verlag Zürich gedenkt meiner Schwester Adelheid mit der Wiedererweckung ihres literarischen Werks. Bereits am 28. August 2020 schrieb mir Erwin Künzli vom Limmat Verlag:
„…tatsächlich haben wir jetzt den Plan gefasst, alle gesammelten Erzählungen Ihrer Schwester herauszugeben zum 25. Todestag im nächsten Jahr. Auch sollen ein Symposium stattfinden und Führungen an ihre Orte und so weiter.“
„Fern von hier“ heisst das voraussichtlich über 500 Seiten starke Buch, dessen Umschlag in der jetzt veröffentlichten Vorschau des Verlags mit einem beeindruckenden Jugendbild meiner verstorbenen Schwester präsentiert wird. Adelheid war noch unverheiratet, hiess also noch nicht Duvanel, sondern Adelheid Feigenwinter, und sie wurde - um 1959/1960 - im Jugend- und Musikcafé Atlantis in Basel fotografiert, wo sie als stille Einzelgängerin oft zu sehen war. Ihre ersten Kurzgeschichten erschienen damals unter dem Pseudonym Judith Januar in den „Basler Nachrichten“.
Felix Feigenwinter, im Dezember 2020
Dichtermuseum Liestal und Adelheid Duvanel
In der basellandschaftlichen Kantonshauptstadt Liestal hat sich im vergangenen Jahr der einheimische Ruheständler Albert Wirth, früher u.a. Redaktor der Ciba-Geigy-Zeitung in Basel, mit verschiedenen Vorstössen für die Pflege des öffentlichen Andenkens der hier gross gewordenen Schriftstellerin Adelheid Duvanel-Feigenwinter eingesetzt. Mit einer Rede im Bürgerrat plädierte Albert Wirth dafür, zur Erinnerung an die 1996 verstorbene Autorin einen Weg, eine Strasse oder einen Platz in Liestal nach ihr zu benennen, und mit fundierten schriftlichen Eingaben an Einwohnerräte seiner Partei (CVP) versuchte er, diese zu veranlassen, sich für eine angemessene Berücksichtigung von Adelheid Duvanel, meiner Schwester, in der Dauerausstellung des Dichtermuseums zu engagieren. - Für sein herzhaftes, unermüdliches Engagement danke ich Albert Wirth! Die von ihm deutlich zur Sprache gebrachte Ungereimtheit (Adelheid Duvanels fehlende Präsenz in der Dauerausstellung des Dichtermuseums ihres Herkunftsortes) ist kulturpolitisch brisant; das Anliegen, dieses Manko zu beheben, benötigt wirksame Unterstützung.
In der Veranstaltungs-Vorschau des Dichter- und Stadtmuseums Liestal lese ich nun im Internet, dass am 4. Juni 2021 im Museum die beiden Herausgeberinnen des dieses Jahr im Limmat Verlag Zürich erscheinenden Adelheid Duvanel-Buches „Fern von hier“, Professorin Elsbeth Dangel-Pelloquin und Friederike Kretzen, „diese von ihnen betreute Gesamtausgabe vorstellen werden“. Ausserdem soll der Adelheid Duvanel-Verehrer Dr. Albert M. Debrunner (Basel) „über seine Bemühungen berichten, in Basel die Erinnerung an die bedeutende Autorin wachzuhalten“, und die Kulturaktivistin und Literaturvermittlerin Martina Kuoni „erzählt aus dem schwierigen Leben der Adelheid Duvanel, die einen Teil ihrer Kindheit in Liestal verbrachte“. In der Zeit zwischen 5. Februar und 4. Juni 2021, also innerhalb von fünf Monaten, möchte Kurator Dr. Stefan Hess in seinem relativ kleinen Museum nicht weniger als achtzehn Veranstaltungen zu verschiedenen Themen über die Bühne bringen; jene über Adelheid Duvanel soll die letzte sein, bevor das Museum zwecks Renovation vorübergehend schliesst. Aufgrund bisheriger Erfahrungen ist nicht auszuschliessen, dass das ehrgeizige Programm wegen der auch im neuen Jahr trotz Freigabe von Impfstoffen verschärften Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unterminiert werden könnte. Dessen ungeachtet bleibt die Hoffung, dass in der dann neu zu gestaltenden Dauerausstellung im Museum an der Liestaler Rathausstrasse ein Platz für Adelheid Duvanel eingeräumt wird.
Felix Feigenwinter, im Januar 2021
-----------------------------------------------
Späte Genugtuung
Antwort auf eine e-mail der Herausgeberin der Adelheid Duvanel-Gesamtausgabe "Fern von hier", Professorin Elsbeth Dangel-Pelloquin (Januar 2021):
Sehr geehrte Frau Prof. Dangel,
Herzlichen Dank für Ihr freundliches Schreiben vom 12. Januar. Die Wiedererweckung des literarischen Werkes meiner Schwester ist für mich eine höchst erfreuliche Überraschung. Trotz diverser Altersbresten, Beeinträchtigungen wegen chronischer Krankheiten, auch Belästigungen durch Spätfolgen eines Unfalls/Sturzes im vergangenen Jahr erfüllt es mich mit Genugtuung, und ich versuche nun, Ihre Fragen zu beantworten.
Da Sie Texte meiner Frau über Adelheid erwähnen, gehe ich davon aus, dass Ihnen das Buch „Scheherezadel – Eine Basler Autorin wird entdeckt“ (1998, Verlag Isishaus) vertraut und zugänglich ist. Dort finden Sie auf Seite 29 ein Verzeichnis des Frühwerks (30 Texte) mit den jeweiligen Erscheinungsdaten der „Basler Nachrichten“. Die Liste beginnt mit der Erzählung „Im Schatten des Irrenhauses“ (3.7.1960) und endet mit der Geschichte „Die Käferwohnung“ (17. 3. 1968). Das wäre die Antwort auf Ihre Erkundigung, ob alle Texte im BN-Sonntagsblatt (also in den Beilagen der Samstagsausgaben) erschienen seien oder anderswo, auch in den Ausgaben der übrigen Wochentage. Im genannten Verzeichnis ist auch angegeben, wenn ein Text nicht im Sonntagsblatt, sondern auf einer BN-Feuilleton-Seite veröffentlicht wurde, wie: „Das Ziel“ (9.1.1961, im Feuilleton, nicht Sonntagsblatt“) und„Wilborada und das Wildschweinchen“ (20.3. 1962, BN-Beilage „Blickpunkt“) - mehr kann ich dazu leider nicht mehr sagen, da ich alles meine Schwester betreffende Material vor vielen Jahren dem Schweizerischen Literaturarchiv in Bern sowie später den Rest, vor allem Bilder, dem „Museum im Lagerhaus“ in St. Gallen überlassen habe.
Vor etwa 25 Jahren habe ich wochenlang im Zeitungsarchiv der UB Basel die in den Sechzigerjahren, vorerst unter dem Pseudonym Judith Januar, in den BN erschienenen Geschichten herausgesucht und kopiert und dieses Material Herrn Vaihinger vom Verlag Nagel&Kimche zur Verfügung gestellt, der es an Peter von Matt weiterleitete, welcher es dann fürs Buch „Beim Hute meiner Mutter“ verwendete.
Im Verlauf Ihrer Recherchen wurden Sie vielleicht auch auf den Katalog zur Ausstellung „Wände, dünn wie Haut“ (2009) im Museum im Lagerhaus St. Gallen aufmerksam, der eine repräsentative Auswahl der von Adelheid gezeichneten und gemalten Bilder vorstellt und dazu eine bemerkenswert umfassende und vertiefte Analyse von Kuratorin Dr. Monika Jagfeld der Merkwürdigkeiten des schwierigen Lebens sowie des bildkünstlerischen und literarischen Werks von Adelheid Duvanel liefert. Dazu der Link: https://unterricht.phwa.ch/wp-content/uploads/2017/07/Duvanel-Bilder-und-Texte.pdf
Der hochinteressante, auch informativ wertvolle Text von Monika Jagfeld enthält leider einen kleinen Fehler, vermutlich aufgrund eines Missverständnisses bzw. einer Verwechslung: „In den 70er Jahren publiziert sie unter dem Namen Martina kleine Tiergeschichten und Alltagsfeuilletons („Allzu Privates“ ) in der Basellandschaftlichen Zeitung...“, schreibt Frau Jagfeld. Meines Wissens ist aber in der Basellandschaftlichen nie etwas von Adelheid erschienen. Vielleicht kam Frau Jagfeld irrtümlich darauf, weil damals ein Teil des „doppelstab“ unter dem Titel „Baselbieter Anzeiger“ erschien. Sie schreiben ja richtig, dass es sich um eine "doppelstab"-Kolumne handelte. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die betreffenden Typoskripte dem Literaturarchiv übergeben. Für den "doppelstab" arbeitete ich zwischen 1965 und 1971 als freier Journalist, und nach einem Unterbruch von zwei Jahren, die ich als Alleinredaktor der aargauischen "Freiämter Zeitung" in Wohlen verbrachte, zwischen 1973 und 1980 als festangestellter Redaktor. Somit ist davon auszugehen, dass "Allzu Privates" in den Siebzigerjahren erschienen ist.
Im übrigen habe ich alles Wesentliche, was ich über meine Schwester, ihr Leben und ihr Schaffen zu sagen hatte und habe in meinen vier Texten „Persönliche Erinnerungen an meine Schwester Adelheid Duvanel“, „Zwerg Julius und das Riesenfräulein“, „Adelheids Reisen ans Meer“ sowie „Ein schwieriges Leben“ festgehalten. Diese schrieb ich mit noch frischem Gedächtnis; heute bin ich 81jährig, und die Erinnerungen sind zum Teil verblasst.
Nun hoffe ich, dass ich Ihnen dennoch einige für Sie nützliche Hinweise und Informationen geben konnte.
Mit freundlichen Grüssen
Felix Feigenwinter
______________________
Fast 800 statt ca. 540 Seiten
Die Vorbereitungsarbeiten für die vom Limmat Verlag geplante Gesamtausgabe des schriftstellerischen Werks meiner Schwester Adelheid Duvanel entwickelten sich intensiv und zum Teil kompliziert, aufwändig auch bezüglich der Abklärung aller Veröffentlichungsrechte.
Noch im Dezember 2020 wurde der Umfang des Buches in der Verlagsavorschau mit "ca. 540 Seiten" angekündigt. Am 2. Februar 2021 schrieb mir dann die Herausgeberin Prof. Elsbeth Dangel-Pelloquin: "...der Band wird dick und dicker." Und am 15.März: "...der Band (vielleicht werden es auch drei, das ist noch nicht entschieden) wird viel dicker, als wir das je gedacht haben." Am 8. April meldete Erwin Künzli vom Limmat Verlag: "Gestern ist alles in Druck gegangen, es sind jetzt 792 Seiten geworden."
Heute, im Wonnemonat Mai, halte ich eines der ersten druckfrischen Exemplare glücklich in meinen Händen: Das Werk ist vollbracht! Das Buch "Fern von hier" umfasst fast 800 Seiten, es ist auch äusserlich unverwechselbar, ein nicht nur umfangreicher, sondern auch sehr gediegener Band mit einem Jugendporträt der Autorin auf dem Cover, aufgenommen vor über sechzig Jahren im Café Atlantis in Basel, wo die damals noch unverheiratete Adelheid Feigenwinter oft zu sehen war (sie schrieb damals Geschichten, die unter dem Pseudonym Judith Januar in den "Basler Nachrichten" veröffentlicht wurden). Diese Gesamtausgabe ist die Krönung von Adelheids schriftstellerischem Schaffen.
Felix Feigenwinter, im Mai 2021
____________________________________
Austellung "Adelheid Duvanels Himmel" in Zürich
Eine Ausstellung in der Galerie Litar, Letzistrasse 23, Zürich, zeigt Adelheid Duvanel in ihrer Doppelbegabung als Schriftstellerin und bildende Künstlerin.
"Lange ein Geheimtipp, gilt sie heute als eine der wichtigsten Autorinnen der Schweiz. Ihr Werk ist eine Entdeckung: poetisch, surreal und von grosser Radikalität."
30. Oktober 2021 bis 11. Dezember 2021.
Dank der wohlwollenden Initiative meines aufmerksamen Sohnes konnte ich trotz meinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nun doch noch diese aparte kleine Ausstellung besuchen. Am letzten Samstag im November fuhren wir nach Zürich an die Letzistrasse zur Galerie Litar, die - für mich überraschend - in einem Wohnquartier fast versteckt zu finden ist. Hier erlebte ich eine erinnerungs-schwere späte Wiederbegegnung mit dem tragischen Leben und dem Werk meiner Schwester Adelheid.
Felix Feigenwinter Ende November 2021.
_______________________________________________________
WARUM SCHREIBE ICH GESCHICHTEN? – MEINE SCHWESTER ADELHEID – ERLEBNISSE MIT EINER RABENKRÄHE und andere Texte in Felixfeigenwinter’s Blog: http://felixfeigenwinter.wordpress.com
_________________________________
Unideologisch denken ist schwierig
Ich versuche, ideologiefrei zu denken - was angesichts der kulturellen Prägung der Denkstrukturen schwierig ist.
Felix Feigenwinter, Tagebuch-Eintrag Februar 2022
_________________________________________
Munter durchs Greisenalter
Auszug aus einem Brief an Florence W., Basel:
(...) Als kränkelnde Alte haben Gunild und ich, zermürbt von Arztbesuchen, Therapiealltag und gelegentlichen Abstechern in der Notfallklinik, uns aus dem öffentlichen/gesellschaftlichen Leben zurückgezogen, bemühen uns aber trotzdem, uns relativ munter durchs Greisenalter zu bewegen. Diabetes (Gunild und ich), Herzkranzerkrankung (ich), Prostatakrebs (ich), Überfunktion der Schilddrüse (Gunild), Parkinson (Gunild), Arthrose (ich) etc. erfordern Disziplin bezüglich Diät und regelmässiger Einnahme von Medikamenten. Seit über 17 Jahren spritze ich z.B. täglich Insulin (ohne diese Spritzen würde ich vermutlich längst nicht mehr leben). Auch genügend Erholungszeit wegen lähmender Müdigkeit, körperlicher und psychischer Erschöpfungszuständen beanspruchen Raum, für Gesunde kaum nachvollziehbar, wie ich immer wieder erfahren muss. Seit meinem letzten schweren Sturz auf dem Centralbahnplatz (zwei Gehirnblutungen) funktioniert mein Gehirn nur noch sporadisch nach Wunsch. Aber klagen nützt nichts. Seit Dezember durchhumple ich mein 83. Lebensjahr; letzte Woche wurde Gunild zweiundachtzig.
Mit einem schönen Gruss Felix Feigenwinter. Basel, 16. Mai 2022
_________________________________________________________________
Hier eine kleine Auswahl aus der Sammlung von rund 50 kurzen und langen Geschichten, die Felix Feigenwinter neben seiner hauptberuflichen journalistischen Arbeit und späteren anderen Erwerbstätigkeiten geschrieben hat:
Das Konzert der Barfüßer
Von Felix Feigenwinter
Unter offenem Himmel liebkosen barfüssige Sänger in zerfledderten Kleidern ihre Musikinstrumente; rauhe, zärtliche Stimmen bejubeln die rhythmischen Klänge und verzaubern einen Platz, an dessen Rand sich Samstagsnachmittagskonsumenten in Freizeitbekleidung auf hohen Stühlen in einem Strassencafé räkeln. Obwohl es Herbst ist, Mitte Oktober, bestrahlt sommerliches Licht die gotische Fassade der Barfüßerkirche, die jetzt ein Museum beherbergt, wo das Gebein keltischer Ureinwohner zu besichtigen ist. Valentin hat die exotische Gruppe durchs Tramfenster entdeckt. Er war unterwegs zum ziemlich öden Vorstadtquartier, wo er wohnt, bepackt mit einer Einkaufstasche eines Supermarktes, und er stieg hastig aus. Jetzt versteckt er sich zwischen den Cafégästen, die den Straßenmusikern blasiert applaudieren und ein wenig Geld locker machen. Gebannt lauscht er der fremdländischen Musik, die so leidenschaftlich an seine Seele pocht, dass sie zu zerbersten droht. Gegenüber, hinter den Musikern, auf der breiten Steintreppe, die zur Kirche führt, feiert ein jüngeres Publikum den ekstatischen Jubel, sich versonnen im Rhythmus wiegend - ein bewegter bunter Haufen. Mitten drin sieht er eine Frau - sie lächelt und winkt ihm zu. Valentin grüßt zurück, gar zart, geradezu scheu, ja greisenhaft verklärt, wie ihn selber dünkt.
Eine Stunde mag er andächtig gehorcht haben. Wieder und wieder sucht sein versunkener Blick die Zauberin - vergeblich. Unbemerkt muss sie aufgestanden, weitergezogen sein. Das Sonnenlicht weicht von der Kirchenfassade, das Himmelsgewölbe erblasst; die Musik der Barfüsser ist verstummt. Ein Schwarm Vögel flattert über den verlassenen Platz und verliert sich auf den Dächern. Valentin stellt sich vor, Tauben würden von einem Turmfalken gejagt. Er fröstelt, will aufstehen, doch Schmerzen lassen ihn zurücksinken. Seit Wochen plagen ihn rheumatische Anfälle. Arbeitskollegen empfahlen ihm, einen Arzt aufzusuchen, aber die Anmeldung hat er immer wieder aufgeschoben. An seinem Arbeitsplatz im Büro hängt ein bebilderter Zeitungsausschnitt mit der Überschrift: "Entspannungsübungen: Unauffälliges Turnen im Büro." Ächzend schleppt er sich und die Einkaufstasche zur Haltestelle. Die Arthritis brennt und sticht, aber er denkt: Lieber spüre ich sie, als dass ich mich von Tabletten betäuben lasse! Die Melodien der Straßenmusiker klingen in ihm nach, berauschen immer noch seine Sinne. "Der Schmerz ist meine zuverlässige Geliebte", summt er, halb verzückt, halb verzweifelt improvisierend. Die eisigen Blicke eines Ehepaars lassen ihn jäh verstummen, das Lied droht in der Kälte zu erstarren. Auf der Traminsel stößt er mit einer gehbehinderten Frau zusammen, der er, humpelnd auch er, nicht rechtzeitig ausweichen kann. Valentin verbeugt sich ungelenk, stammelt eine Entschuldigung. "Ach was", krächzt die Greisin und klopft ihm mit ihrem Stock gegen den Bauch, "so spüre ich mich wenigstens, weiß ich, dass ich noch lebe."
Das Tram fährt vor. Mit leidender Miene müht sich Valentin hinein, lässt sich auf einen Sitz fallen. Bewegungslos würde er sich durch die Strassen flitzen lassen, immer wieder neue Passagiere würden zusteigen, alte würden ihn verlassen, und staunend würde er von Endstation zu Endstation sausen bis tief in die Nacht hinein... das könnte interessanter werden als ein Fernsehfilm! Aber es ist Herbst, und das Rheuma erheischt Pflege; das Übernachten im Tramdepot kann kein Ziel sein. Die Barfüßer steigen ein und eröffnen einen musikalischen Wirbel. Valentin zieht Schuhe und Socken aus, die Schmerzen scheinen verflogen. Seine nackten Füße klatschen auf den platten Boden, der Körper zuckt besessen zu den wilden Rhythmen der Fremden, die des Tanzenden Ekstase lachend, singend und schreiend begleiten.
Wie lange das gespenstische Treiben im Tramanhänger währte, ist ungewiss. Der Tramführer jedenfalls will nichts bemerkt haben. Sicher ist nur, dass er nach Mitternacht, als er im Depot nach Abschluss der Fahrt im Spätdienst einen letzten Kontrollgang durchführte, den Mann im Anhänger am Boden liegend fand. Der Tod sei durch Herzinfarkt eingetreten, hielt später der Arzt fest, der die Leiche im gerichtmedizinischen Institut obduzierte. Über den Freudentaumel stand nichts im medizinischen Bericht.
Der Retter
Von Felix Feigenwinter
Mario lässt sich erschöpft auf sein Bett fallen. Nur die Hose hat er ausgezogen, um die Bügelfalten zu schonen; sie hängt, schon etwas zerknittert, über der Lehne eines Stuhls, über dem ein Bild schwebt, das er früher selbst gemalt hatte, als er noch Künstler werden wollte. Mario weiß inzwischen, dass seine Bilder von niemandem begehrt oder auch nur gebraucht werden; er versuchte es später als Kunsthändler, aber auch damit hatte er keinen Erfolg. So trat er schließlich in eine Versicherungsgesellschaft ein, wo man ihn vor kurzem zum Abteilungsleiter vorgeschlagen hat.
Durchs offene Fenster, durch den Spalt der Gardinen, dringen gebrochene Sonnenstrahlen und für Mario zum Teil unerklärliche Geräusche: ein sich hartnäckig wiederholendes metallisches Kratzen (vielleicht eine Katze oder ein Vogel im Dachkänel); ein dumpfes Scharren; dazwischen die klaren Stimmen spielender Kinder; im Hintergrund das verschwommene Dröhnen von Automotoren, ein heilloses Durcheinander. Dann plötzlich auch das Rauschen eines Wasserstroms. Mario wundert sich: seines Wissens gibt es in diesem Quartier keinen Fluss, auch nicht in der näheren Umgebung! Aber das lang anhaltende Geräusch ist nicht zu überhören, auch nicht zu verwechseln. Der vergebliche Wunsch, dieses Rätsel zu lösen, nimmt Marios Gedanken für Minuten gefangen. Schließlich vermutet er, eine Halluzination zu erleben; mit dieser Vermutung schlummert er ein.
Als er erwacht, dringen unangenehm scharfe Stimmen durch den Gardinenschlitz: es sind Nachbarsleute, die auf einer Dachterrasse ein Fest feiern. Ihre schrillen Kommentare über ein gewesenes oder kommendes Fußballspiel haben ihn geweckt. Die Sonne ist längst über den Dächern verschwunden.
Nachdem er geduscht hat, verlässt Mario das Haus, die aufgeregten Nachbarn auf der Dachterrasse ohne Gruß hinter sich lassend.
Nach einer Fahrt in die Dämmerung gelangt er ans Ufer eines Flusses, der, als Folge der Gewitter der letzten Nacht, viele Hölzer, ja ganze Sträucher und kleine Bäume mit sich schwemmt. Eine Weile staunt Mario in den wild reißenden Strom, bis er sich selber in die Fluten stürzt. Er ist ein guter Schwimmer, und er vermutet, dass er, wenn er nur will, nicht untergehen müsste. Aber diesen Ehrgeiz verspürt er schon gar nicht mehr. Er beschließt, sich vollständig dem Wasserstrom hinzugeben, und er empfindet dies als weitaus angenehmer als die Auslieferung an die Vorgesetzten im Geschäft, die Kämpfe um höhere Umsätze und das verlangte Renommiergehabe unter den Arbeitskollegen in der Firma, deren Ziele er schon lange nicht mehr begreift. All diese enttäuschenden, erwürgenden Erfahrungen sind für ihn nur noch blasse Erinnerungen, geradezu lächerlich, und auch die am Ufer jetzt auftauchenden Häuser, Autos und menschliche Gestalten erfasst Mario als schnell vorüberziehenden, schattenhaften, für ihn bedeutungslosen Spuk. Nur sehr undeutlich, verzerrt, sieht er einen die Arme schwenkenden Mann am Ufer, der ihm etwas zuzurufen scheint. An mehr kann sich Mario nicht erinnern.
Als er das Bewusstsein wiedererlangt, beugt sich ein Arzt mit grüner Gesichtsmaske über ihn. Man hat ihn aus den Fluten in die Notfallstation des Kantonsspitals überführt. Auch sein Retter ist anwesend; er schüttelt Mario die Hand, als ob er seinen Dank erzwingen wollte, und tatscht ihm kumpelhaft an die Schulter. Da Mario seit jeher ein schlechtes Namensgedächtnis hat, was ihm auch seine Arbeit bei der Versicherungsgesellschaft erschwert, vergisst er den Namen des Retters sofort. Er vermutet aber, er würde in der Zeitung publiziert; vielleicht würde der Mann sogar als Held ausgezeichnet und von einem Regierungsrat empfangen. Diese Überlegungen bedrücken und befremden ihn; der einzige Gedanke, mit dem er sich noch identifizieren kann und der ihn auch beschäftigt, als man ihn nach Hause entlässt, mündet in die Frage: „Was wollen die von mir?“
Eine Antwort darauf scheint das Schreiben zu enthalten, das Mario an jenem Morgen seinem mausgrauen Briefkasten entnimmt, auf dem zwei verwitterte Kleber befestigt sind, die er zum erstenmal wahrnimmt. „Mehr Geld. Jahr für Jahr“, liest er auf dem einen, grünumrandeten, „Ruhige Reise“ auf einem himmelblauen, auf dem ein Männchen mit Koffer auf einem roten Scheckheft sitzt. Aus dem Briefumschlag zieht Mario einen „Kursbefehl“ des Amtes für Zivilschutz zu einem „Grundkurs für Schutzraumchefs". Als Kurszweck wird die „Einführung in die Aufgaben des Schutzraumchefs“ und die „Grundausbildung zum Vorgesetzten für die Leitung und Betreuung im Schutzraum“ angegeben. Fassungslos starrt Mario auf den Zettel, auf dem mit roter Farbe der Hinweis „Gilt als Aufgebot“ aufgestempelt ist. Der Name des Kursleiters scheint identisch zu sein mit jenem, den ihm sein Lebensretter zugeraunt hatte. Mario hält es für möglich, ja geradezu für zwingend, dass ihm der Retter den Kursbefehl geschickt hat. Der Zusammenhang scheint einer quälenden Logik zu entsprechen.
(Erschienen am 10.11.1985 in der „Literaturzeitung“)
Keine grosse Liebe
Von Felix Feigenwinter
Eine grosse Liebe ereigne sich in einem Frauenleben einmal, höchstens zweimal, hatte ihr die Grossmutter eingeschärft, in deren Obhut Frau Braun nach dem Drogentod ihrer heroinsüchtigen Mutter aufgewachsen war. Die Grossmutter hatte ihre grosse Liebe an einen Triebtäter verschwendet. Frau Braun fand Grossmutters Lebenslüge abscheulich. Als Enkelin einer Frau, die ihre Gefühle einem Unwürdigen verschenkte - einem Kinderschänder! - , misstraute sie allen Glücksversprechungen, auch ihren eigenen Gefühlen.
Eines Morgens erreichte sie die Liebeserklärung eines Unbekannten, deren Identität ihr verborgen blieb. Das handbeschriebene Papier, den sie ihrem Briefkasten entnahm, verschwieg Namen und Adresse des Absenders. Erstaunt las sie die Zeilen eines Anonymlings, der sie aus einem Versteck heraus ansprach. Gezielt, doch feige, unfassbar wie ein Gespenst, übergoss er sie.
Da sich der okkulte Verehrer nicht mehr meldete, verflüchtigte sich Frau Brauns Irritation allmählich. War er ein poetisch veranlagter Spassvogel, ein frivoler Spieler, ein leidenschaftlich Besessener? Frau Braun zwang sich, den Vorfall zu vergessen. Das Gedicht, diese wahnwitzige Liebeserklärung eines Unsichtbaren, hatte sie eine Zeitlang in ihrer Handtasche aufbewahrt; von Zeit zu Zeit holte sie es hervor und las es im Stillen.
Als sie noch keinen Wunsch nach einem eigenen Kind verspürte, fuhr sie manchmal in eine fremde Stadt, um Unerwartetes zu erleben. So schlenderte sie einmal durch eine ihr endlos scheinende Geschäftsstrasse einer Metropole und bewunderte die Schaufenster der Bijoutiers. Plötzlich, wie im Traum, betrat sie einen dieser Läden, betört durch einen besonders prächtigen, selten grossen und strahlenden, in geschmeidiges Gold gefassten Diamanten, der mit keinem Preisschild versehen war. Sogleich erschien ein in aparte Seide gekleideter, dezent parfümierter junger Herr, der sie mit unbewegt freundlicher Miene vom Scheitel bis zur Sohle diskret musterte und sich gleichzeitig in leise süffisantem Ton nach ihrem Begehren erkundigte. Mit stockender, vor Verlegenheit belegter Stimme fragte sie nach dem Preis der im Schaufenster strahlenden Köstlichkeit. Ihre kindliche Verblendung, ihre wahnhafte Begeisterung war angesichts des distinguierten Jünglings relativiert worden, der aus einer für sie in Wirklichkeit unerreichbaren Welt vor ihr aufgetaucht war. Der feine junge Herr lächelte beharrlich, nun aber eher bedauernd als süffisant, wie ihr schien (er ist eben doch ein kultivierter Mensch mit angenehmen Manieren und vielleicht sogar Herzensbildung, erwog Frau Braun, möglicherweise der Sohn des Geschäftsinhabers). Mit höflicher Stimme sagte er: "Vierundsiebzigtausend". Erschüttert verbeugte sich Frau Braun, flüchtete aus dem Laden, ein unsinniges "Aufwiedersehen!" und "Entschuldigung!" stammelnd; dabei versuchte sie, jeden Blickkontakt mit diesem Prinzen aus dem Reich der Millionäre und Milliardäre zu vermeiden, obwohl er ihr die Türe hielt.
Nach dem Tod ihrer Grossmutter suchte Frau Braun eine andere Wohnung, um quälenden Erinnerungen zu entrinnen. Nachdem sie in ihr neues Heim eingezogen war, eine Dreizimmerwohnung im Haus eines Herrn Tellenbach, erfuhr sie nach und nach Einzelheiten aus der Vergangenheit des neuen Wohnungsvermieters.
Nicht dass sie Tellenbach gefürchtet hätte; dieser grossgewachsene alte Mann verhielt sich ihr gegenüber vom ersten Tag an korrekt, wie ihr schien, sogar freundlich und hilfsbereit. Doch ihr fehlte die Erfahrung mit einem Menschen, der, wie eine Nachbarin erzählt hatte, seinen Chef umgebracht hatte. Sie war ratlos, wie sie mit ihm umgehen sollte. Anfänglich genierte es sie, ihm im Treppenhaus oder im Garten zu begegnen. Frau Braun arbeitete zu einem bescheidenen Monatslohn in einer Holzofenbäckerei mit angegliedertem Laden, in dem sich auch ein kleines Café befand; dort hatte sie Tellenbach kennengelernt, und er hatte ihr die Wohnung angeboten.
An einem Vorfrühlingsabend war sie spät von der Arbeit nach Hause gekommen. Immer noch in Schuhen, begoss sie ihre Blumen aus der Plastikkanne, die tagsüber und nachts im Badezimmer die Tropfen aus einem undichten Wasserhahn sammelte. Tellenbach war über den ärgerlichen Defekt informiert; er hatte ihr schon letzte Woche versprochen, für Abhilfe zu sorgen, doch bisher war nichts geschehen. Auf dem Balkon schob sie das Katzenleiterchen zurecht, das der Wind während ihrer Abwesenheit verrückt hatte, in der Hoffnung, ihr von der Grossmutter geerbter, seit Tagen vermisster Kater würde endlich zurückkehren. Danach zog sie sich ins Wohnzimmer zurück, um fernzusehen. Noch bevor sie den Apparat anstellte, hörte sie vom Fenster her ein Kratzen. Der angelehnte Fensterflügel wurde aufgeschoben - ein Schatten huschte ins Zimmer. "Diamant" sprang zu ihr aufs Sofa, begrüsste sie schnurrend, kitzelte sie mit seinem Barthaar, der Heuchler. Und während sie sich über das Wiedersehen freute, den Kater zärtlich streichelte, schrillte die Wohnungsglocke. Als sie die Tür öffnete, stand Tellenbach vor ihr, einen Werkzeugkasten in der linken Hand schwenkend. In ihrer Euphorie hätte sie den Mann umarmen können (statt dessen lachte sie nur; sie dachte an die Nachbarin, die ihr erzählt hatte, ihr Mann sei wegen Tellenbach eifersüchtig geworden, nachdem dieser in ihrer Wohnung die Toilette reparieren kam: "Du bewunderst Männer, die Klodeckel flicken können", habe er gegiftelt.) Nachdem Tellenbach den lecken Wasserhahn im Badezimmer dicht gemacht hatte, bat sie ihn ins Wohnzimmer und offerierte ihm ein Glas Wein aus der Flasche, die er ihr beim Einzug in die Wohnung zur Begrüssung geschenkt hatte.
"Gut, dass Ihr Tier wieder zum Vorschein gekommen ist", meinte er, als er den Kater erblickte, "es hätte mich nicht gewundert, wenn man erzählen würde, der schreckliche Tellenbach habe die Katze eingefangen und als Gulasch verzehrt!"
"So etwas würde ich nie von Ihnen denken!" heuchelte Frau Braun erschrocken.
"Das meine ich auch nicht", begütigte der Gast auf dem Sofa; "ich esse übrigens gar keine Tiere, ich bin überzeugter Vegetarier. Aber sicher hat Ihnen auch schon jemand erzählt, ich hätte als gelernter Zahntechniker eine Bestattungsfirma gegründet, um den Toten das Zahngold aus den Mündern zu klauen?"
"Man munkelt viel", wagte Frau Braun zuzugeben, "etwa, sie hätten früher ihren Lehrmeister getötet."
"Das ist richtig. Das habe ich getan, als junger Mann. Ich erschoss meinen Chef; er war der Besitzer des zahntechnischen Labors, wo ich meine Lehre machte. Der Kerl war ein Sadist. Er hat mich bis aufs Blut gedemütigt. Ich könnte Ihnen den ganzen Roman erzählen, aber was soll's... Ich habe für meine Tat gebüsst, habe einige Jährchen meiner Jugend im Gefängnis verbracht."
Tellenbach schien Wert darauf zu legen, sie davon zu überzeugen, dass er kein Mörder sei, sondern ein Idealist, der leidenschaftlich gegen Unterdrückung und für Gerechtigkeit kämpfe.
Frau Braun war verstummt ob der Bekenntnisse des kauzigen Alten. Tellenbach holte weiter aus: Als ihm jemand seinen Namen "Wilhelm Tellenbach" auf dem Schild seiner Bestattungsfirma mit blutroter Farbe überschmiert und auf "Wilhelm Tell" gekürzt habe, habe er die Schmiererei neben dem Hauseingang absichtlich gelassen, bis zur Liquidation des Betriebs. "Sie können das Schild heute in meiner Wohnung bewundern. Wilhelm Tell! War das ein Mörder?"
Die bizarrste Nacht ihres Lebens durchwachte Frau Braun in den Armen des grauen Heroen, der sie schwängerte. Sie trug das Kind aus, mit stolzer Beharrlichkeit und Würde, im Glauben, dass sie den verrückten alten Kerl aus dem Dachstock zwar nie heiraten würde, dass er aber sie und ihr Kind nicht im Stich lassen wolle. Dem Alten gegenüber verspürte sie keine Zuneigung, schon gar keine "grosse Liebe", nichts dergleichen; sie verdankte ihm ihr Kind, das genügte. Insgeheim hielt sie sich für eine Geschädigte. Nach heftigen Gefühlen nach einem Mann stand ihr nicht der Sinn.
Doch Tellenbach machte keine Anstalten, für das Kind aufzukommen. Er erklärte ihr, sie sei selber schuld; er habe nie ein Kind gewollt.
"Vo nyt kunnt nyt!"
Von Felix Feigenwinter
Ich kenne keinen würdigeren Vertreter schweizerischer Arbeitsmoral als meinen ehemaligen Lehrer Valentin Stämpfli. Zielbewusst erzog er uns zum spartanischen Verzicht auf alles, was er für "unnützen Zeitvertreib" hielt. "Unnützer Zeitvertreib" war jede Tätigkeit - und selbstverständlich erst recht jedes Nichtstun - , die keinen AHV-pflichtigen Lohn erzielte. Einziger Zweck unseres Daseins war in Stämpflis Vorstellung die materielle Absicherung des späteren Rentnerlebens. So verstand er die Schule als eine Ausbildungsstätte für Generationen pflichtbewusster AHV-Beitragszahler. Nichts unterließ er, um uns Arbeitsdisziplin und Ehrfurcht vor dem Drei-Säulen-Konzept der Altersvorsorge einzutrichtern. Unter dem Motto "Vo nyt kunnt nyt!" führte er seine gefürchteten Noten-Schriftlichen durch und überhäufte uns mit Hausaufgaben, die unsere Freizeit in anstrengende Leistungssitzungen verwandelten. "Vo nyt kunnt nyt!" hieß für Herrn Stämpfli: unentwegtes Chrampfen bis zur Erreichung des AHV-Alters.
Aber nicht, dass Sie jetzt denken, Herr Stämpfli sei ein schmarotzerischer Heuchler gewesen, der andere zu verbissener Arbeit angehalten hätte, um sich selbst ein um so genüsslicheres Leben zu verschaffen! Nichts von alledem. Jahrzehntelang büffelte er in seiner Freizeit an seinem Lebenswerk, das er unter dem Titel "Ohne Fleiß kein Preis" als Buch herauszugeben beabsichtigte. Da kein Verleger Interesse bekundete, gründete Stämpfli schließlich einen Selbstverlag. Wenige Tage nach der Auslieferung seiner Bücher besuchte ich den kurz vor seiner Pensionierung stehenden Lehrer in seiner Wohnung. Er saß an seinem Schreibpult zwischen den Büchertürmen und wirkte irgendwie verklärt. "Die dritte Säule meiner Altersversorgung", erklärte er mir, indem er auf die hoch aufgeschichteten Folianten zeigte. In seinem sonst so zerquälten Antlitz bemerkte ich zum erstenmal den Anflug eines stolzen Lächelns. Die Aussicht, das Lebensziel bald erreicht zu haben, schien ihn zu entspannen. Ihn, der sich sogar in seinen langen Schulferien jegliches Ausspannen versagt hatte! Noch mussten für die Bücher allerdings Leser gefunden werden - und Buchhändler, die gewillt waren, das Werk unter die Leute zu bringen...
Eine Woche nach meinem Besuch in Stämpflis bücherverstelltem Heim kippte einer der Türme. Nicht dass die Bücher Herrn Stämpfli erschlagen hätten, aber der Schreck über den Einsturz der dritten Säule brachte sein angegriffenes Herz offenbar zum Stillstand. So fand er doch noch seine Ruhe, wenngleich anders als lebenslang geplant.
An Stämpflis Beerdigung begegnete ich mehreren früheren Schulkameraden. Mit pflicht- und fleißzerfurchten Gesichtern stämpflischer Prägung umstanden sie das Grab des verehrten Lehrers. Die einzig lockere Gestalt an dieser Beerdigung war Fridolin; er hatte sich kaum verändert. Als wir uns einst in Stämpflis Klassenzimmer über unsere Grammatikschriftlichen beugten, lehnte sich Fridolin lässig zurück und zeichnete Vögel: Tauben, Schwäne und Störche. Das war seine Spezialität - und das einzige, was er in der Schule wirklich konnte: Vögel zeichnen. Fridolin hat nie eine Abschlussprüfung bestanden, beendete somit auch nie eine Berufslehre, und aus der Rekrutenschule kehrte er - wen wundert's! - bereits nach drei Wochen zurück. Er wurde "miltitärdienstuntauglich" erklärt. Auch die Arbeitsstellen, die er von Zeit zu Zeit antrat, verließ er bald unverrichteter Dinge.
Später traf ich ihn einmal sonntags im Zoologischen Garten, wohin ich mit meiner Frau und den Kindern spaziert war. Fridolin saß auf einer Bank und zeichnete Störche. Nach einigem Zögern kaufte ich ihm ein Bild ab. Er gestand mir, dass er davon leben müsse. Ein anderes Einkommen habe er nicht.
Einige Jahre danach berichtete mir meine Frau, als ich abends vom Büro nach Hause kam, sie habe Fridolin in der Stadt getroffen. Es gehe ihm jetzt gut, er beziehe eine Invalidenrente, und im Rahmen der Ergänzungsleistungen seien ihm für mehrere tausend Franken die Zähne saniert worden. Auch kleide er sich jetzt gepflegter als früher, und er mache sich bei Frauen beliebt. Jedenfalls werde er häufig von Damen zum Essen eingeladen, wie er ihr anvertraute. Anders als die Männer, die während neun Stunden täglich im Büro sitzen, habe er nun eben viel Zeit, in Cafés zu flirten. Er wisse stets drollige Geschichten zu erzählen. Dem Bericht meiner Frau musste ich entnehmen, dass sich Fridolin vom Clochard zum Gigolo entwickelt hatte.
Gestern nun, als ich auf meinem Velo zur Arbeit fuhr, habe ich ihn selber gesehen. Vor dem Rotlicht, wo ich mein Zweirad abstoppte, hielt neben mir ein schnittiger Sportwagen. Der Mann, der die Autoscheibe herunterkurbelte, um mich grinsend zu grüßen, war Fridolin. Neben ihm saß eine junge Dame am Steuer, die ich als "sehr gut aussehend" bezeichnen möchte. Sie schien auch sonst nett zu sein; jedenfalls lächelte sie mir freundlich zu. "Brigitte, meine Braut", stellte sie mir Fridolin vor, der übrigens tatsächlich in eleganten Kleidern steckte. "Übermorgen fliegen wir in die Flitterwochen!" Sie werden verstehen, dass ich einigermaßen verdattert war! "Wie verdient man solches Glück?" konnte ich nur noch stottern. Fridolin lehnte sich zurück, bleckte vergnügt sein makelloses Gebiss: "Vo nyt kunnt nyt!" Dann wechselte das Ampellicht auf Grün, und das glückliche Paar brauste fröhlich winkend davon.
(Erschienen in der "Ciba-Geigy-Zeitung" am 4. Febr.1986)
Der brüllende Zoodirektor
Von Felix Feigenwinter
Es war ein sonniger, strahlender, aber keinesfalls tropischer Tag. Ein lindes Windchen durchlüftete die Sonnenwärme. Kein Hitzestau, keine hundstägliche Bewusstseinstrübung war nachzuweisen. Die Sonne stach nicht, sie schien vielmehr freundlich und mild, verhielt sich gewissermassen mitteleuropäisch-zivilisiert.
Abgründiges, Erschreckendes hatten die vernünftigen Organisatoren schon bei der Planung des Rundgangs durch den Zoo ausgeschlossen: Die Raubtierkäfige mit der manchmal wild knurrenden und zähnefletschenden Löwin Yolanda wurden bewusst umgangen. Die Kinderschar durfte so putzige Tierchen wie Zwergziegen und Hängebauchschweine, Waschbären und Erdmännchen bewundern. Weiter ging's zu den Pinguinen, zum Affenfelsen, und schliesslich blieb der muntere Besuchertrupp vor dem Gehege jener schmucken Steppenpferdchen stehen, die Zebras genannt werden. Die Idylle schien abgerundet zu sein.
Da meldete sich ein vielleicht siebenjähriger Knirps, der Kleinste unter den Kindern. Er hatte schon bei den Erdmännchen eifrig aufgestreckt und da wohl auch den Begriff "Aasfresser" aufgeschnappt. Nun wollte er vom auskunftswilligen Vertreter des Zoologischen Gartens wissen: "Sind Zebras Aasfresser?" - "Nein, Grasfresser", belehrte der Zooangestellte, und er schilderte geduldig die Existenzbedingungen der gestreiften Vierbeiner im heimatlichen Afrika. Der Knirps wollte noch mehr erfahren: "Können Zebras schnell klettern?" - "Klettern?" stutzte der Zoomensch, verblüfft über die exotische Fragestellung, "die leben ja nicht im Gebirge wie zum Beispiel die Steinböcke. Sie müssen also gar nicht klettern!" - Doch der Bub beharrte auf seiner Vorstellung: "Wie klettern sie denn das Leiterchen hoch?" Er zeigte zum Häuschen im Gehege, wo tatsächlich eine Leiter zu einer Maueröffnung in der Höhe führte. - "Ach so, das meinst du", begriff der Zoomensch, "die Leiter ist für die Wärter!" - "Sind sie Aasfresser?" fragte der Knirps ebenso stereotyp wie ernsthaft. - "Das hast du doch schon gefragt, und ich habe gesagt, die Zebras fressen Gras", erwiderte der nun doch etwas ungeduldig gewordene Zoomensch. - "Nicht die Zebras, die Wärter meine ich", präzisierte der Knirps. - "Die Wärter?!" rief nun der Zoomensch einigermassen verstört, "ja Herrschaft - was essen die Wärter? Spiegelei und Rösti. Salat. Nudeln. Birchermüesli. Auch mal eine Wurst oder ein Kotelett. Nichts Besonderes, wie wir alle..."
Der Zoomensch begann sich wieder auf seine eigentliche Aufgabe zu besinnen. "Die Fragestunde ist hiermit beendet", verkündete er, "ich hoffe, es hat euch allen gefallen! Der Verkehrsverein offeriert nun noch jedem von euch einen kleinen Imbiss." Und er führte die Kinderschar ins Zoorestaurant.
Doch die Lernbegierde des Knirpses war damit noch keineswegs gestillt. Beim Birchermüesli-Schmaus liess er sich erklären, wer die Tiere wie einfängt und in den Zoo bringt. Und er wollte wissen, wo der Zoodirektor wohnt. Vielleicht im Häuschen im Zebragehege, in das der Wärter über die Leiter klettert? - "Nein, nein, in einer normalen Menschenwohnung, wie wir alle", versicherte der Zoomensch. - "Wie sieht der Direktor aus?" forschte der Knirps weiter. Um Missverständnisse über das Aussehen eines Zoodirektors ein für allemal zu zerstreuen (etwa phantastische Vorstellungen über ein gerüsseltes, gehörntes, gehuftes oder ähnlich märchenhaftes Wesen), fasste der Zooangestellte die günstige Gelegenheit beim Schopf und wies zur lauschigen Ecke des Zoorestaurants, wo zufällig der Zoodirektor mit seiner Gattin an festlich gedecktem Tisch sass. "Der Herr, den ihr dort mit seiner Frau seht, ist unser Zoodirektor. Ein ganz normaler Mann!" erklärte der Angestellte mit angemessen respektvoll gedämpfter Stimme.
"Was isst der Direktor?" war nun die nächste Erkundigung des nimmermüden Fragestellers. Darauf blieb der allzu strapazierte Zooangestellte eine Antwort schuldig. Eine unverständliche Ausrede murmelnd, flüchtete er hastig hinter die Toilettentür. Hier erst, am stillen Oertchen, platzte ihm der Kragen: "Himmelarschundschtärneaffebrunzundelefanteschyssdräggnoonemool!" (*) hallte seine fluchende Stimme durchs Pissoir, "eine solche Nervensäge wie dieses penetrant fragende Kind ist mir in meinem ganzen bisherigen Leben noch nie begegnet!"
Es gibt aber immer noch aufmerksames Restaurationspersonal. Die Serviertochter verriet den Kindern, was der Direktor bestellt hatte: "Rehrücken!"
Wen wundert's, dass nun die ganze Kinderschar neugierig zur Tafel starrte, wo der Zoodirektor mit seiner Frau offenbar gerade einen Geburtstag, ein Hochzeitsjubiläum oder ein anderes festliches Ereignis feierte. Der Oberkellner schleppte ein Silbertablett herbei, auf dem tatsächlich ein köstlich garnierter Rehrücken lag.
"Ein Aasfresser!" staunte der Knirps. In diesem Augenblick überwältigte den Zoodirektor ein behagliches Gähnen, und noch bevor er seinen breit geöffneten Mund mit vorgehaltener Handfläche diskret verdecken konnte, drang durchs offene Fenster aus dem angrenzenden Raubtiergeviert ein fürchterliches Gebrüll.
Yolanda hatte gesprochen! Für die Birchermüesli essenden Kinder freilich sah es so aus, als ob der Zoodirektor höchstpersönlich gebrüllt hätte. Und so wurde der Rehrücken speisende Direktor zum beeindruckendsten Erlebnis ihres Zoobesuchs.
(*) baseldytsch. (Himmelarschundsternenaffenurinundelefantenscheissdrecknocheinmal)
(Diese Geschichte ist am 12. August 1986 im "Nebelspalter" erschienen)
HEXENFEUER
Von Felix Feigenwinter
Eines Sommerabends habe ein Mann oder Männlein – jedenfalls ein männliches Wesen – das Lokal betreten und sei keineswegs entschlossen, sondern zögerlich auf den Frauenstammtisch zugesteuert, sei dort stehengeblieben, habe herumgetruckst, bis es scheu, ein wenig linkisch eine der sieben Damen anzusprechen gewagt habe. Offenbar habe es gefragt, ob am Tisch noch ein Platz frei sei, was eine der Frauen (eine nicht mehr ganz junge, aber noch keineswegs alte, sondern lebhafte, heitere, blühende Dame) lachend mit temperamentvoll einladenden Gesten bejaht habe, worauf sich das etwas bekümmert dreinblickende, schmächtige Herrlein scheinbar verdutzt über den eigenen Mut inmitten der inzwischen bereits ausgelassenen Runde niedergelassen habe. Vorerst sei der kleine Mann noch etwas verloren dagesessen, bis ihm der Kellner den gewünschten Wein hingestellt habe. Danach sei der Fremde nach und nach aufgeblüht, habe das Palaver der lebensfrohen Weiber mit munterer Neugier verfolgt, mehrmals Wein nachbestellt, und er sei in die Unterhaltung immer mehr einbezogen worden. Ja, das anfänglich verklemmt, geradezu vergilbt wirkende Männlein habe sich im Verlauf des Abends zu einem brillanten Chauseur und Charmeur entwickelt. Etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht sei es inmitten des fröhlich palavernden Septetts aufgebrochen und habe, zusammen mit den Frauen, die ihm übrigens die Zeche bezahlt hätten, ein Taxi bestiegen.
Das alles sei umso erstaunlicher, als es sich beim Damenclub um eine Versammlung radikaler Feministinnen gehandelt habe, in deren Haus am Stadtrand sonst keinen Männern Einlass gewährt worden sei. Die sieben Sufragetten hätten sich bereits in mancherlei Hinsicht als Männerschreck profiliert, obwohl man es – und dabei handle es sich um seine ganz persönliche, gewissermassen private Meinung, zu der er aber jederzeit stehe – mit durchaus attraktiven Damen zu tun gehabt habe.
So ungefähr schilderte mir, der ich zum erstenmal und rein zufällig in diese Quartierspelunke geraten war, Hansjörg Graber, ein pensionierter Postverwalter, während er an jenem Abend im Restaurant „Diana“ in der Altstadt mehrere Deziliter Rotwein trank, seine einstigen Beobachtungen aus dem sicheren Späheck am Jasstisch schräg gegenüber des runden Stammtisches, wo sich die sieben Frauen jeden Montagabend getroffen hätten, wie Graber weiter erzählte.
An seinem Arbeitsort, so spintisierte der weinselige Rentner weiter, hätten die Postangestellten ihre Köpfe zusammengereckt und über das Verschwinden des geheimnisvollen Fremden spekuliert, der seither in der Stadt nie mehr gesichtet worden sei. Schliesslich hätte ein Gerücht sowohl am Jasstisch als auch im ganzen Quartier die Runde gemacht: Danach hätten die sieben Frauen den Zwerg verhext und in ihrem Haus auf unsägliche Weise missbraucht, ja, schliesslich gar ermordet, wobei schauerliche Details nur andeutungsweise und hinter vorgehaltener Hand zur Sprache gekommen seien. Ein anderes Gerücht verbreitete die unbehagliche Nachricht, der Fremde sei in Wahrheit ein Hexenmeister, ein listig getarnter, unheimlicher Zauberzwerg gewesen, der zusammen mit den Frauen Unheilvolles ausgeheckt und das Quartier, ja die ganze Stadt habe ins Verderben stürzen wollen.
So sei es nur zu verständlich gewesen, dass sich bald kein Briefträger mehr gefunden hätte, der das Hexenhaus habe aufsuchen wollen, um die dorthin adressierte Post abzuliefern. Die Briefe und Pakete seien im Postkeller gesammelt und jeden Monat bei Vollmond im Hinterhof des Postgebäudes verbrannt worden, wobei die Flammen, welche die Hexenpost habe vertilgen müssen, von Monat zu Monat heftiger gelodert hätten; das Ritual habe zusehends mehr Zuschauer angezogen.
Ein wahres Höllenfeuer aber hätten die Quartierbewohner in einer Vollmondnacht im darauffolgenden Frühling erlebt: Allen sei sofort klar gewesen, dass es sich nicht um das rituelle Postvernichtungsfeuer habe handeln können, allzu wild seien die Flammen am Rande der Altstadt in den Maihimmel gelodert. Das Haus der sieben Frauen habe lichterloh gebrannt, und nachdem das Inferno von der Ortsfeuerwehr endlich habe gelöscht werden können, habe von ihren Bewohnerinnen jegliche Spur gefehlt. Ein Zeuge habe sie auf Besen durch die Luft schiessen und im nahen Buchenwäldchen entschwinden sehen. In der Asche des ausgebrannten Gebäudes habe man die verkohlten Reste eines kleingewachsenen Mannes gefunden, bei dem es sich nach Ansicht der Untersuchungsbeamten um den Brandstifter gehandelt habe.
Erst viel später – der pensionierte Postverwalter, der mir diese grausliche Geschichte vor einigen Jahren weintrunken erzählt hatte, war inzwischen verstorben – , fanden Bauarbeiter im Garten des niedergebrannten Hauses, wo nun ein Gebäude für die städtische Verwaltung gebaut werden sollte, die Skelette von sieben beerdigten Frauenleichen, wie ich von der Wirtin des Restaurants „Diana“ erfuhr, nachdem ich wieder einmal in dieser Pinte, wo ich nie zu den Stammgästen gehörte, eingekehrt war. Seither würde der grosse runde Stammtisch, wo früher die sieben Frauen jeweils gefeiert hätten und wo einst der rätselhafte Zwerg auf sie getroffen sei, in jeder Vollmondnacht zum Andenken an diese Frauen mit sieben Flaschen Wein und sieben Gläsern gedeckt und mit sieben Kerzen und einem grossen Blumenkranz geschmückt. Einen Tag und einen Abend lang dürfe sich dann kein Gast an diesem Tisch niederlassen, berichtete die Wirtin weiter, die übrigens einen durchaus bodenständigen Eindruck hinterliess und beteuerte, sie habe den ominösen Zwerg mit eigenen Augen gesehen.
Ankündigung im Herrenzimmer
Von Felix Feigenwinter
Als der Sohn am Abend in die Wohnung seiner Eltern kam, die er seit seinem Auszug vor vielen Jahren nur noch selten besuchte, betrat er vorsichtig das Herrenzimmer seines Vaters und schnupperte den süsslichen Duft angefaulter Aepfel. Seit langem wunderte er sich, warum dieser Raum von den Eltern "Herrenzimmer" genannt wurde (Vater hielt sich darin auf; Herren hatten sich hier aber nie versammelt). Die gedrungene Gestalt verharrte am Schreibtisch vor dem Fenster, im abendlichen Gegenlicht wirkte sie wie ein unheimliches, geducktes Tier. Erst als der Sohn nähertrat, bemerkte er, dass der alte Mann eingeschlafen war; er atmete schwer, schnarchte leise vor sich hin, den Kopf zwischen beiden Fäusten festgehalten, die wie Klumpen aus den Armen hervorgekrochen schienen. Auf dem Pult sah der Sohn die Insulinspritze liegen, die der zuckerkranke Vater regelmässig benützte, daneben einen Kugelschreiber und ein beschriebenes Blatt Papier; der Vater hatte einen Leserbrief an die Lokalzeitung entworfen, einen Diskussionsbeitrag zu einem lokalen Streitthema, eine Erinnerung an frühere Kämpfe. Neben dem Briefentwurf stand ein leeres Trinkglas, dahinter das braune Fläschchen, aus dem der Vater von Zeit zu Zeit Tropfen zur "Anregung und Normalisierung der sekretorischen Funktionen im Magen-Darm-Gallen-Bereich" zu sich nahm, da er sich davon Linderung seiner chronischen Gastritis erhoffte, schon seit Jahrzehnten, wie es dem Sohn schien. In Griffnähe stand die Obstschale, die vier zum Teil schon angefaulte Aepfel enthielt; eine der Früchte war angebissen, das künstliche Gebiss zeichnete sich im Fruchtfleisch wie ein Mahnmal ab. Der Sohn erinnerte sich, dass Vater früher einmal vergessen hatte, für eine wichtige Versammlung, wo er hätte reden sollen, sein Gebiss anzuziehen - zahnlos war er zur Veranstaltung gefahren. Erst im Versammlungsraum wurde er sich des Mangels bewusst, und er flüchtete panisch nach Hause.
Noch ehe es der Sohn verhindern konnte, rutschte ein Arm des Vaters zur Seite, und die Stirn prallte seitwärts auf die Briefskizze auf dem Schreibtisch. Der alte Mann fuhr auf, lächelte verlegen, als er den Sohn im Abenddämmer entdeckte. "Ist was?" fragte er leise. In diesem Moment betrat die Mutter das Herrenzimmer und drückte auf den Lichtschalter. Des Vaters Kopf schien nun zu schrumpfen; aus dem runzeligen Gesicht blinzelte es treuherzig ins Helle.
"Es ist etwas vorgefallen, ich muss Euch eine Veränderung ankündigen" antwortete der Sohn (er wunderte sich, mit welch' ruhiger und tiefer Stimme er plötzlich sprach), "Ihr müsst hier ausziehen, der Hausbesitzer hat Euch gekündigt. Das Haus wird abgebrochen. Ich werde Euch fürs Altersheim anmelden!"
Die starken Worte des Sohnes bewegten die Eltern. Die Mutter wich zum Vater, umklammerte mit beiden Händen dessen Schultern.
Der Sohn glaubte, zwei alte Kinder zu sehen, die ihrem Schicksal sprachlos ausgeliefert schienen.
BÜROGESCHICHTEN
Lächeln untergräbt Arbeitsdisziplin
von Felix Feigenwinter
In jener Firma, wo Philipp seinen Lebensunterhalt verdient, ist der Austausch leidenschaftlicher oder zärtlicher Blicke ebenso verpönt wie herzliches Lachen oder Pfeifen. Was immer die verlangte Arbeitsdisziplin zu untergraben droht und das tun eigentlich alle persönlichen, un-sachlichen Bedürfnisse -, wird mittels Weisungen, internen Mitteilungen und Personalnachrichten eingeschränkt oder ganz eliminiert. In dieser Öde abgewürgter Emotionen ähneln die Menschen immer mehr den Computern, an denen sie zu werkeln haben. An einer Kadersitzung hatte man zu einem entscheidenden Schlag gegen letzte Möglichkeiten individueller Arbeitsplatzgestaltung ausgeholt: Man verlangte eine noch straffere Pausenordnung und das strikte Verbot von Zwischenverpflegungen in den Büros. Philipp, vor kurzem zum Abteilungsleiter befördert, probeweise gewissermassen, war skeptisch, ja traurig gestimmt, und er lächelte, um die Stimmung besser ertragen zu können. Wie von den übrigen Kadermitgliedern erwartete man von ihm die vorbehaltlose Unterstützung der verfügten Massnahmen. Statt dessen zuckte er widerspenstig die Achseln und trug sein melancholisches Lächeln zur Schau. Erst die dezidierte Aufforderung des Vorsitzenden, endlich eine deutliche Stellungnahme zu äussern, versetzte ihn in eine schrille Heiterkeit, eine Art Galgenhumor. Zwar vermied er es, laut herauszulachen; aber sein Lächeln gedieh zum abgrundtiefen stummen Grinsen, und dieses schien der Betriebsleitung noch mehr zu missfallen. Kurze Zeit später erfuhr Philipp von seiner Absetzung als Abteilungsleiter. An seine Stelle trat ein neueingestellter Computerfachmann, eine dynamische, karrierebewusste Kraft; sie stellte sich als Schorsch Bonz vor, und Philipp vermied bei der Vorstellung jedes verfängliche Lächeln. Man versetzte Philipp in ein kleines Büro, das er mit einer altgedienten Kollegin zu teilen hat, einer Frau Nörgeli. Dort starrt er nun ganztags auf einen Computerbildschirm; das Grinsen hat seine Degradierung zum gewöhnlichen Sachbearbeiter bewirkt. Aber er trägt sein Schicksal mit Fassung und lächelt wieder, wenngleich diskret, gewissermassen versteckt, ohne eine Provokation zu suchen, still vor sich hin. Nur manchmal, in der Freizeit, überfällt ihn das Bedürfnis, laut herauszulachen. Das geschah kürzlich in der Halle des Hauptpostgebäudes, wo er vor einem Schalter in einer Menschenschlange stand, um einen einge¬ schriebenen Brief aufzugeben. Leider hatte er es unterlassen, vor seinem Heiterkeitsausbruch die Umgebung aufmerksam zu betrachten. Sonst hätte er bemerkt, dass in der Schlange nebenan, schräg vor ihm, Schorsch Bonz anstand. Bonzens grimmiger Blick signalisierte ihm zu spät, dass der Bürochef das Lachen auf sich bezog und beleidigt war, weiss der Himmel, weshalb. Das veranlasste Philipp, zu überlegen, welche innerbetrieblichen Auswirkungen sein öffentliches Lachen haben könnte. Eine Degradierung zum Aktenableger hält er für unwahrscheinlich - aus dem einfachen Grund, weil nach der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung sämtliche Akten abgeschafft worden sind; somit sind Aktenableger überflüssig geworden. Daher bleibt wohl nur noch die Entlassung, und da würde ihm das Lachen dann schon vergehen!
(Erschienen im Nebelspalter, 1987, Heft 1)
Der Frühling im Büro
Von Felix Feigenwinter
Das Amt, in dem Fridolin Knoll als Abteilungsleiter und Herr Knüsel als Sachbearbeiter seit Jahren tagaus tagein ihren Dienst versehen, hatte mit der Einstellung von Frau Röösli eine sonderbare Veränderung erfahren: Wenn der Abteilungsleiter das Büro betrat, begrüsste ihn Frau Röösli von einem der Computertische herunter, wo sie barfüssig an neuen Vorrichtungen für die Schlingpflanzen bastelte. Sachbearbeiter huschten giesskannenbewehrt durch die Gänge. Sie versteckten sich im grünen Dickicht ihrer Arbeitsplätze und flüsterten Liebeserklärungen ins buschige Laub, streichelten zärtlich aufkeimende Sprösslinge. Mit Lupengläsern suchten sie nach Läusen. Wurden sie fündig, fingen sie Marienkäfer, denen sie die Blattläuse zum Frasse vorsetzten. Aus dem Gebüsch flötete eine chinesische Nachtigall. Sie pickte den Sachbearbeitern aus der Hand, jagte und verschlang aber auch Marienkäfer. So wuchs die Lauspopulation. Dies wiederum gefährdete das Wachstum der Pflanzen.
Während einer Geschäftsleitungssitzung schilderte der Abteilungsleiter die drastischen Veränderungen seit dem letzten Urlaub. Nach einem kurzen Augenschein beschloss die Direktion, das Büro räumen zu lassen. Frau Röösli wurde entlassen.
Ein Jahr nach diesen Vorfällen schreitet der Abteilungsleiter Fridolin Knoll zum Fenster, öffnet es gewissenhaft, beugt sich über das Gesims, schnuppert forschend, tritt zurück, breitet die Arme aus und verkündet mit ergriffener Stimme: "Der Frühling hält seinen knospenden Einzug!" Das Büro erstarrt ob solchen Worten, die Beamten blicken verzerrt und verzückt auf den knospenden Strauch vor dem Fenster, der Mutigste wagt eine beipflichtende Bemerkung. Die dienstälteste Sachbearbeiterin eilt zum Fenster, schliesst es beflissen und sachte, worauf Herr Knoll durchs Büro flaniert, sich scheinbar prüfend über ein herumliegendes Dossier beugt. Fragte man ihn, was er im Dossier suche, er vermöchte es, so wird seit langem vermutet, nicht zu erklären. Seine Bewegungen ähneln den salbungsvollen Verbeugungen der Priester in den Hochämtern mit Segen.
Frau Wunderlich hat Herrn Knolls Frühlings-Zeremonie verstohlen vom Computertisch aus verfolgt. Ein Gespenst hat sie besucht. Vorletzte Woche begegnete es ihr auf dem Heimweg, im Abenddämmer, und seither folgt es ihr Tag für Tag. Es wartet im Bürovorraum und begleitet sie nach Hause. Nachts setzt es sich auf ihre Brust und schleicht sich in ihre Träume ein. Manchmal vergisst sie es während der Arbeit. Dann glaubt sie, es sei ein Traumgespenst. Zwischen dem Computergeplapper hört sie sein Schnalzen durch die Empfangshalle schallen; sie riecht es und hat das Gefühl, es laure hinter einer Ritze der Bürotür, luge durch die Glasscheibe des Publikumsschalters.
Frau Wunderlich hämmert wie wild auf die Computertasten. Ihre Kollegen sehen sie prüfend, fast scheu an. Sie legen ihre Arbeit zur Seite, spähen nachdenklich durch die Fensterscheibe auf die Vögel im Strauch. Das hektische Klappern erinnere sie an das Zerkleinern von Suppengemüse auf einem Hackbrett, erklärt Frau Knoblauch, die dienstälteste Sachbearbeiterin. Der sonst so schweigsame Herr Knüsel räuspert sich und deklamiert mit anschwellender Stimme:
"Die Amsel vor dem Fenster singt
die Sonne durch die Scheibe strahlt
der Kosmos in das Büro dringt
das Amt den Lohn mit Küssen zahlt!"
Gestern hatte Frau Wunderlich Herrn Knüsel gefragt, ob er sie abends, nach der Arbeit, in eine Gartenwirtschaft begleite. Unter einem Kastanienbaum tranken sie grosse Biere. Im Abenddämmer leuchtete Knüsels roter Haarschopf wie ein Hahnenkamm; tanzende Fledermäuse umschwirrten die Gäste. Auf die Rückseite einer Getränkekarte schrieb der Büropoet ein Gedicht, das er Frau Wunderlich überreichte.
Heute, frühmorgens, hing Knüsels Gedicht am Informationsbrett im Verwaltungsbetrieb; der Bürovorsteher Fridolin Knoll stand kopfschüttelnd davor. Alsdann riss er die Karte vom Brett, zerknüllte sie und warf sie in den Papierkorb.
Herr Knoll wischt sich Schweissperlen von der Stirn, bevor er sich würdig schnäuzt. Er spricht davon, sich vielleicht frühzeitig pensionieren zu lassen.
Der Büroalltag nimmt seinen geordneten Fortgang.
Blockzeit
Fred sass hinter dem Personalcomputer und betrachtete durchs Fenster die Dächer der gegenüberliegenden Häuser. Sein Staunen galt dem Phänomen, dass Schnee nur noch das Dach eines einzigen Hauses bedeckte, bis ihm einfiel, dass dort die Fensterläden seit Monaten geschlossen waren. Das Haus schien seit langem unbewohnt, und das war wohl der Grund, warum der Winter das Giebeldach noch immer belagerte; offensichtlich war nie mehr geheizt worden, keine Wärme unter dem Dach trieb die Schneeschmelze an.
Christs Anwesenheit nahm er erst später wahr, als er ein Räuspern vernahm, das ihn erschreckte und seine Beschaulichkeit zerstörte. Er fragte sich, wann Christ das Büro betreten habe. Vergeblich versuchte er sich zu erinnern, das Geräusch der sich öffnenden Tür bemerkt zu haben. So vermutete er, der Abteilungsleiter sei vor etwa zehn Minuten ins Büro gekommen, als Frau Erhart zur viertelstündigen Morgenpause aufgebrochen war; dann hätte ihn Christ während Minuten heimlich beobachtet, wortlos hinter ihm stehend. Fred wagte nicht, sich vorzustellen, wie er sich während dieser Zeitspanne verhalten habe. Meistens riss er, nachdem die durchzugsgefährdete Frau Erhart in Richtung Aufenthaltsraum im Korridor verschwunden war, das Fenster auf, und er zündete eine Zigarette an, deren Rauch er gierig einsog, ruhelos im Büro hin- und herwandernd, wie ein gefangenes Tier. Die Gier, die ihn in Abwesenheit der Nichtraucherin Frau Erhart täglich erfasste, war unbändig. Heute hatte er nicht geraucht, weil er am frühen Morgen, auf dem Weg zum Verwaltungsgebäude, vergessen hatte, Zigaretten zu kaufen. Anders als sonst war er am Pult sitzengeblieben, sonst wäre ihm Christs Anwesenheit aufgefallen. Ein Fensterflügel stand freilich offen; den herbeiströmenden Wind hatte er wie ein erfrischendes Bad genossen; der Schein der Frühlingssonne glitzerte, und vom Dach des unbewohnten Nachbarhauses tropfte Schneewasser in die Pflanzenrabatten, wo Amseln die Erde bepickten.
"Haben Sie um elf Uhr Zeit?" fragte Christs Stimme. Sie tönte wie üblich gesiebt, von emotionellen Spuren vollständig gereinigt, wirkte gleichförmig, unbewegt. Fred bejahte; Christs Erkundigung konnte nur rhetorisch gemeint sein, war somit hämisch. Aber die Schadenfreude, die ihr zugrunde lag, war nicht zu denunzieren - oder hätte Fred erwähnen sollen, elf Uhr sei innerhalb der Blockzeit; er müsse heute morgen weder zum Arzt noch zu einer Beerdigung eines nahen Verwandten (andere Verrichtungen ausserhalb des Verwaltungsdgebäudes waren für ihn während der Blockzeit nicht vorgesehen; Dienstreisen, wie Kaderleute ihre Ausflüge während der Blockzeiten deklarierten, blieben für gewöhnliche Angestellte unerreichbar; diese hatten hinter ihren Personalcomputern zu verharren, seit der Einführung der Zweiundvierzigstundenwoche mit einem Unterbruch von zweimal fünfzehn Pausenminuten während täglich achteinhalb Stunden, inbegriffen die Kompensationszeit für verlängerte Wochenenden an Ostern und Pfingsten). Fred antwortete kurz, korrekt, mit einem Beben in der Stimme; seine Empörung über Christs bewusste oder unbewusste Perfidie versuchte er wie alle Empfindungen persönlicher Art zu verbergen, und er nickte scheinbar beflissen, nachdem Christ erklärt hatte: "Man erwartet Sie zu einer Besprechung im kleinen Sitzungszimmer". Vielleicht hätte Christs Gesichtsausdruck nähere Hinweise gegeben, ein maliziöses Lächeln etwa, oder eine forciert starre Maske, aus deren Oeffnungen die Bosheit zuckte.Aber Fred sah immer noch durchs Fenster, bemerkte zwei Männer in blauen Uebergewändern und mit roten Hüten, die ein angerostetes Metallrohr über die Pflanzenrabatten schleppten, und er erinnerte sich an eine interne Mitteilung der Geschäftsleitung, wonach "schneller als erwartet mit den Installationen für Probebohrungen im Hinblick auf den Neubau begonnen" werde; es sei vorgesehen, an drei bis vier Stellen hinter dem Verwaltungsgebäude Bohrlöcher für Bodensondierungen zu erstellen. Leider sei mit Lärmimmissionen und zeitweise mit Einschränkungen der Parkierungsmöglichkeiten zu rechnen; man erwarte selbstverständlich, dass der Arbeitseinsatz dadurch nicht beeinträchtigt würde. Als sich Fred endlich umsah, hatte der Abteilungsleiter in seinem Rücken das Büro bereits verlassen; Fred schloss den Fensterflügel und setzte sich auf den Sessel zurück.
Kurz, nachdem Frau Erhart von der Pause zurückgekehrt war, durchdrang ein metallenes Klopfen das Schweigen im Büro, verdeckte das Klappern der Computertasten. Die Korrektheit der Kollegin verband sich nahtlos mit der Leidenschaftslosigkeit, welche die Büroräume durchspannte, sicherte den vorgeschriebenen Umgang zwischen den angestellten Menschen, die austauschbar schienen. Der Lärm der Sondierungsbohrung vermochte Frau Erharts Verhalten auch nicht zu ändern, und nach einer Weile sah Fred auf die Uhr und sagte, um elf Uhr müsse er zu einer Besprechung im kleinen Sitzungszimmer, und er erhob sich und schickte sich an, das Büro zu verlassen; dabei streifte sein Blick Frau Erhart, in deren Gesicht er geduckte Abwehr las, ja Zeichen nur mühsam unterdrückter Angst.
Als er das Sitzungszimmer erreichte, fand er es menschenleer. Er beschloss, Geduld zu üben und hielt es für angemessener, stehend oder herumgehend statt sitzend zu warten. Seine unbestimmte Bange versuchte er zu mildern, indem er, ähnlich dem Besucher einer Kunstgalerie, einer Wand entlangschlenderte, um ein dort aufgehängtes Oelgemälde aus der Nähe zu betrachten. Er sah die Darstellung einer Parkanlage, eine glühende Sommerlandschaft mit erregenden Ausblicken, eine leidenschaftliche Expression, zu der keine Büroseele fähig schien. Noch während er sich im Bild verlor, gleichsam darin spazieren ging, betraten drei ihm bekannte Herren, unter ihnen der Abteilungsleiter Christ, das Sitzungszimmer; man hiess Fred Platz nehmen.
Sein Blick blieb auf dem Oelgemälde haften; er entsann sich eines sommerlichen Sonntagnachmittags: Nachdem er im Stadion ein Fussballspiel verfolgt hatte, verspürte er das Bedürfnis, aus der Menschenmenge zu flüchten, mit sich allein zu sein, und er geriet auf dem Heimweg in einen Park. Ein Gewimmel von kinderreichen Familien säumte den Rasenrand; unter dem wispernden Laub der Parkbäume wurde gepicknickt, palavert, gedöst; kleine nackte Kinder plantschten in einem Wasserbecken, und auf den Bänken thronten Rentner und überwachten das Geschehen. Fred schritt auf den schattenlosen Rasen hinaus, der öde war, weil die Hitze so fürchterlich sengte. Er legte sich auf den Rücken ins Gras, das unmerklich zitterte, da ein stiller Wind darüber strich. So ruhte er eine geraume Weile, gab sich der Sonnenglut hin, und schlummerte ein. Aber als er erwachte, fegte ein Sturm durch die menschenleer gewordene Parkanlage. Fred blieb vorerst liegen, starrte auf die herbeihastenden dunklen Wolken, lauschte dem Rauschen des die Baumkronen durcheinanderwirbelnden Winds, bis ihn plötzlich einsetzende Schauer zur Flucht trieben. Er rannte zu einem Kastanienbaum, der ihm Schutz vor dem ungestüm niederprasselnden Regen zu bieten versprach, wurde aber von einem Schlag ins Genick zu Boden geworfen; der Sturm hatte einen Ast gefällt. Und nun lag Fred auf dem Spazierweg, gedrückt vom Ast, und schluchzte vor Schreck und lachte, überwältigt vom Glück, den Blitzschlag überlebt zu haben.
Als Fred ins Büro zurückkehrte, wo Frau Erhart immer noch am Personalcomputer tippte, meldete er mit blasser Stimme, es habe sich um ein Entlassungsgespräch gehandelt; als Familienvater mit sozialen Verpflichtungen träfe es ihn hart, aber er verstehe es auch als eine Chance. Frau Erhart schien kaum aufzuhorchen; ihre Finger hämmerten ungebrochen weiter auf die Tasten, als wollte sie demonstrieren, wie verbissen sie ihre Lebensstelle zu sichern bereit sei.
"Ich gehe nun in die Mittagspause", sagte Fred, und er schob sich in seinen Mantel und verliess das Büro. Als er vor dem Gebäude den Fussgängerstreifen überquerte, fuhr ihn ein Auto beinahe über den Haufen; durch die Windschutzscheibe sah er Christs hämisches Grinsen.
DAS PRODUKT
Von Felix Feigenwinter
Im Museum, wo der ewige Geschichtsstudent Michael Merz als "Mädchen für alles" wirkt, erscheint eines Nachmittags eine mit einer Kamera ausgerüstete Fremde, die im Auftrag des Museumsdirektors das Personal für einen Museumsprospekt porträtieren soll. Weil Michael hier nur halbtags arbeitet, dies freilich schon während etlichen Jahren, fühlt er sich im Kreis der ganztags Beschäftigten immer ein wenig verloren. Dankbar erlebt er die Ankündigung des Fototermins einige Tage zuvor während einer Kaffeepause vor versammelter Belegschaft; der Museumsdirektor scheint ihn nicht auszuschliessen. Kurz vor dem Eintreffen der Fotografin bindet sich Michael eine Krawatte um, um besonders adrett auszusehen - eine für ihn atypische Anwandlung von Koketterie. Doch dann fordert ihn die Fotografin auf, zu lächeln statt düster in die Linse zu starren, wie sie sich ausdrückt, und Michael, der freundlich und erwartungsfroh geguckt zu haben glaubte, bekennt: "Ich bin schwermütig, lache selten!"
"Sie sind ein Produkt!", belehrt ihn hierauf die in einer Werbeagentur angestellte Fotografin, und Michael denkt: Jetzt wartet sie, bis ich mein Gesicht zur Grimasse verziehe. "Was bevorzugen Sie, mein Zahnpastagrinsen oder mein Valiumschmunzeln?", ringt er sich zu einem Witzchen durch und zeigt demonstrativ seine Zähne.
Die Fotografin bittet ihn, etwas übers Museum zu erzählen, was Michael vermuten lässt, davon erhoffe sie sich eine Lockerung seiner verspannten Gesichtsmuskulatur.
"Wie Sie wünschen", antwortet er nun ebenso trotzig wie ratlos, aber plötzlich spürt er eine Euphorie aufkommen, was seine Gedanken phantasievoll spriessen lässt, und aus dem Stegreif improvisiert er eine Geschichte (Bedenken, deren Inhalt würde vielleicht den guten Geschmack verletzen, den der Museumsdirektor seinem Personal im Umgang mit Museumsbesuchern und der Öffentlichkeit immer wieder anmahnt, beschleichen ihn erst im Nachhinein):
"Die Särge morbider Alltäglichkeiten barsten unter dem Einfluss hemmungsloser Überschwemmungen, hervorgerufen durch unerwartetes Beben", beginnt Michael seine Rede; "es entstiegen den Fluten unbekannte Gestalten mit blicklosen Augen, kopflos zum Teil, mit rätselhaften Bewegungen scheinbar ziellos umherstreunend. Überlebende Bürger, durch rechtzeitiges Besteigen einer aus dem Wasser ragenden historischen Stadtmauer dem Ertrinkungstod entkommen, zogen die beunruhigenden fremden Wesen ins Trockene. Dann ordneten und beschrifteten sie sie mit vernünftigen Bezeichnungen. Hierauf setzten sie sie in Kondensgläser und hängten sie in Rahmen, um sie dergestalt in einem eigens dafür geschaffenen Museum der Nachwelt zu erhalten. Erst mit dem Vorbeirauschen der Jahre fiel auf, dass die fremdartigen, doch jetzt ordentlich benannten Wesen sukzessive Blicke entwickelten, die auf den Museumsbesuchern zu ruhen begannen. Als Ausstellungsobjekte verdächtigt liessen die Bürger das Museum schliessen."
Während Michael spricht, knipst die Fotografin ununterbrochen; endlich scheint sie mit ihm zufrieden zu sein.
Nur wenige Wochen später erfährt er, dass der Aufwand vergeblich war: Erste Exemplare des neuen Prospekts werden verteilt, und Michael sucht vergeblich nach dem Foto, das ihn beim Erzählen seiner irrealen Geschichte zeigt. An der Vernissage zur Wechselausstellung, an welcher der neue Prospekt der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, verrät ihm die ebenfalls eingeladene Fotografin während des Apéros im Museumsfoyer, sein Porträt habe man auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers - also des Museumsdirektors - bei der Gestaltung des Prospekts absichtlich nicht berücksichtigt. Der gedemütigte Michael versucht, die Enttäuschung zu verbergen und erklärt der Fotografin selbstironisch: "Weil ich nur halbtags angestellt bin, bin ich offenbar kein geeigneter Museumsrepräsentant. Also doch kein vollwertiges Produkt..." Die Fotografin betrachtet ihn mitleidig, meint achselzuckend: "Sie sind ein kleiner Pechvogel!", und wendet sich einem anderen Gesprächspartner zu.
Michaels Freude ist nun endgültig verflogen. Er verspürt auch keine Lust mehr, bis zu der zu erwartenden knorrigen Ansprache des Museumsdirektors auszuharren. Noch während drei Musikerinnen ihre Instrumente für ein kleines Begrüssungskonzert stimmen, schleicht er sich aus dem Foyer, wo sich die Vernissagegäste eng drängeln, und verzieht sich ins ihm vertraute Museumsarchiv, wo er sich am langen Tisch niederlässt, auf dem seit Tagen vergilbte Dokumente aus dem Nachlass eines verstorbenen Donators auf Sichtung harren. Hier lauscht er den Musikklängen der drei schönen Frauen, die im Foyer ihr Konzert zelebrieren. Dabei fällt sein Blick durchs Fenster auf das Dach eines Nachbarhauses, wo auf einer Fernsehantenne zwei grosse schwarze Vögel sitzen, die ihn durch die Glassscheibe zu beobachten scheinen.
Michael hebt die Hand wie zum Gruss, steht auf und beginnt zur Musik zu tänzeln. Zärtlich, geradezu verzückt bewegt er sich durchs Museumsarchiv. Während er innehält und wieder hinaussieht, bemerkt er, wie sich die Raben flügelschlagend im Takt der Musik zu drehen beginnen. Eine Frauenstimme holt ihn aus seiner Verzauberung. "Entschuldigen Sie", hört er, "ich habe mich verirrt. Ich suche das WC. Sie feiern ganz alleine hier... Tanz eines Unglücksraben?" Jetzt erst sieht er die Fotografin, die mit spöttischem Grinsen im Türrahmen steht.
Michael reagiert gelassen. "Ihr schiefer Humor hat mir gerade noch gefehlt", erwidert er trocken. Dann weist er der Frau, an deren Brust eine Leica hängt, galant lächelnd den Weg zur Toilette.
Nachtarbeit
Von Felix Feigenwinter
Beat Vaterlaus trifft keinen Menschen mehr im obersten Stock des Verlagshauses, wo er sich nach einem hektischen Tag in Konferenzzimmern und auf Reportagefahrt in sein Redaktionsbüro verkriecht.
Der Papierkorb ist bereits geleert, und die glänzende Platte des Schreibtischs mit dem blanken Aschenbecher verrät, dass das Büro geputzt wurde. Er stellt sich vor, wie Frau Angst in einem der unteren Stockwerke herumwischt - eine unverheiratete Frau, die zuhause für eine Tochter zu sorgen hat. Beim Gedanken daran beschleicht ihn etwas wie schlechtes Gewissen: Geisterhaft taucht das Gesicht der Putzfrau vor ihm auf (dieser schmerzliche flackernde Blick, der ihm letzte Woche im Traum erschien, aus dem er in tiefer Nacht zitternd aufschreckte - eine Verwirrung, nach deren Bedeutung er vergeblich rätselte); aber wie so oft verwischt er das Unbehagen über fremden Kummer, indem er sich in die aparten Sorgen seiner eigenen Existenz vertieft.
Der Nachtredaktor würde viel später, gegen Mitternacht, eintrudeln; so würde er, schätzt Vaterlaus, ungestört arbeiten können. Aus Erfahrung weiss er, dass er sich nach zwei, drei Stunden nach Ruhe sehnen wird. Heute, so rechnet er sich aus, würden zwei Stunden genügen, um die Arbeiten zu erledigen, die er sich vorgenommen hat.
Da sieht er den gelben Zettel, den ihm Frau Hasenfratz, die Redaktionssekretärin, auf die Agenda gelegt hat. Für den Besuch der Pressekonferenz des Frauenschutzvereins von heute abend habe kein Berichterstatter gefunden werden können; wenn die Sache wichtig sei, könne vielleicht er selbst hingehen - sonst wolle sie morgen vom Frauensekretariat Unterlagen anfordern oder telefonisch recherchieren, teilt Frau Hasenfratz mit.
Vaterlaus spürt sein Herz hämmern. Einen Herzinfarkt will er nicht erleben, nicht jetzt, nicht hier. Mit ihm hat dieses Büro doch eigentlich nichts zu tun! Lieber möchte er auf einem Spaziergang sterben, in einer Landschaft, wo Sonnenlicht oder Mondschein Baumschatten werfen. Während der heutigen Mittagspause, die lächerlich kurz war, ist ihm wieder bewusst geworden, wie öd die Gegend geworden ist, wo er aufwuchs. Die einst grün bewachsene Erde, auf der er unter Bäumen spielte, ist zubetoniert, asphaltiert. Persönliche Erinnerungen, Gefühle werden weggeplant. Die zarten Frühlingsmorgen, die schattigen, beglückend trägen Sommernachmittage - man hat sie zerstört. Die nachdenklichen Herbste, die stillen Wintertage - ausradiert. Ein Stück seiner Seele hat man gerodet.
Er steht auf, geht zum Fenster und starrt durch die Gardinen in die Hinterhöfe, auf die gegenüberliegenden Hausdächer, die er vergeblich nach Schnee absucht. Viele klagen über Kopfschmerzen und Depressionen, auch die Redaktionssekretärin.
Vaterlaus öffnet einen Fensterflügel. Gierig atmet er die Abendluft ein. Ein sonderbarer Winter. Er erinnert sich an die Kindheit; an knöchelhohen Schnee, durch den er zur Schule watete. An Schlittenfahrten, an die schmerzend kalten Füsse und Hände, die er zusammen zuhause mit seinen Geschwistern am Kohlenofen aufwärmte.
Dann kehrt er zum Schreibtisch zurück. Das Fenster steht sperrangelweit offen, und über den Dächern hasten Wolken vorbei; trotzdem fühlt er sich erhitzt. Er zieht seine Jacke aus und hängt sie über die Stuhllehne, versucht, sich zu erfrischen, indem er die Luft, die durchs Fensterloch ins Büro strömt, langsam und tief einsaugt. Dabei kommt er sich wie ein Waldläufer vor - eine Vorstellung, die ihn erheitert. Spontan fällt ihm eine Schlagzeile ein, die er laut vor sich hinsagt: "Der einsame Kicherer im Abenddämmer"; doch kaum ist es ausgesprochen, findet er es albern, eine absurde Phantasiewucherung, eine Verkrümmung seiner Gedanken, die ihm zu denken gibt. "Wäre blöd, jetzt überzuschnappen, niemand würde es merken, ausser ich selber", hört er sich murmeln; aber diese Feststellung kommt ihm noch wunderlicher vor.
Vaterlaus beginnt, den Schreibtisch aufzuräumen. In zwanzig Minuten beginnt die Pressekonferenz des Frauenvereins; da wird er selber hingehen: er delegiert schlecht, er ist kein Chef. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen und einem Mäppchen unter dem Arm hetzt er aus dem Verlagshaus und taucht in den Abend, der nichts Winterliches an sich hat. Unterwegs, auf einem Fussgängerstreifen, irritiert ihn der artige Gruss eines älteren, ihm nur flüchtig bekannten Ehepaars: "Adie, Heer Doggter!"; eine verschwommene Erinnerung an seine Rolle als Lokalredaktor. Hoch über der Stadt wird eine Wolke zerrissen; es erscheint ein grosser runder Lampion, dessen weisslicher Schein sich auf der Glasscheibe eines auf einen mittelalterlichen Turm gerichteten, nicht eingeschalteten Scheinwerfers spiegelt. In einer Häuserschlucht, durch die er jetzt geht, nähert er sich drei Frauen, die an einer Strassenkreuzung warten. Die eine ruft: "Hallo, Schätzchen!" Vaterlaus lächelt und wechselt, noch bevor er sie erreicht, ausweichend die Strassenseite. Einige Häuser weiter, in der Parallelgasse, betritt er einen Gang und klopft an eine Tür; dahinter erwarten ihn die Damen des Frauenschutzvereins.
Zu seiner Überraschung dauert die Pressekonferenz nicht viel länger als eine halbe Stunde. Als einziger Mann inmitten einer kleinen femininen Zuhörerschaft lauscht er den anklagenden und entschlossenen Worten zweier Frauenrechtlerinnen über die Prostitution weiblicher Sexualität. Die Schilderungen über die Schwierigkeiten von unverheirateten und geschiedenen Müttern und deren Kindern machen ihn sprachlos. Für einen Moment versinkt er in Erinnerungen an seine frühere Frau, von der er längst geschieden ist; dann fühlt er sich zunehmend müder, ausgelaugt, so dass er das abschliessende Diskussionsangebot zu seinem eigenen Bedauern ungenützt verstreichen lässt.
Wieder auf der Strasse, sucht er vergeblich nach dem Mond zwischen den Wolken. Traumwandlerisch, wie auf der Flucht, irrt er durch einen Eingang, aus dem der Gesang von Billie Holliday weht. An der Bar bestellt er einen Zweier Weissen. Verklemmte Männerblicke treffen ihn durch Zigarettenqualm; ein Betrunkener pöbelt die Bardame an. An der Theke erkennt er unter einer Gruppe anderer Frauen die Gestalten, die er auf dem Weg zur Pressekonferenz gesehen hatte; wieder grüssen sie ihn. Dann, unerwartet, das abgehetzte Gesicht von Frau Angst, ihr verletztes Lächeln; im schummerigen Licht des Lokals wirkt es weicher als sonst. Zuerst weicht ihr Blick wie erschrocken aus; nachher scheint sie ihm zuzunicken; die Bestürzung bleibt.
Vaterlaus bezahlt, verlässt die Theke und verabschiedet sich mit einer versteckten Handbewegung. Er verscheucht den ihm unangenehmen Gedanken, Frau Angst verdiene ihren Lebensunterhalt nicht nur als Putzfrau, sondern auch als Prostituierte (da er sie an der Bar eben gesehen hat, stellt er sich vor, dass sie vielleicht wie er nach der Arbeit zufällig hierhin geraten sei).
Zurück im Redaktionsbüro versucht er zu vermeiden, weiterhin an Frau Angst zu denken. Er spannt ein Blatt Papier in die Schreibmaschine und will sich auf die Pressekonferenz konzentrieren, um den Bericht für die morgige Ausgabe zu schreiben.
Ein Würgen verhindert die Arbeit; ein Weinkrampf überwältigt ihn - ein kurzes heftiges Heulen durchdringt die Bürokammer. Als er wieder in seine Rolle zurückzufinden sucht, staunend in seine Einsamkeit hineinhorcht, bemerkt er, dass das eingespannte Papier, über das er seinen Kopf gebeugt hat, tränennass ist, aufgeweicht, ungeeignet, getippte Buchstaben aufzunehmen.
Vaterlaus erhebt sich, geht zum Schalter neben der Tür und knipst das elektrische Licht aus. Es drängt ihn, im Dunkeln zu sitzen, eins zu werden mit der Finsternis. Doch wie er sich zum Schreibtisch zurücktasten will, überrascht ihn der Schein des Monds, der über milchig schimmernde Dächer geradewegs zu ihm ins Büro schimmert.
Der Baggerführer
Von Felix Feigenwinter
Mit seiner Höllenmaschine verwandelte er die Schrebergärten hinter dem Verwaltungsgebäude innert weniger Tage in abgrundtiefe Erdlöcher. Einmal, es war ein kühler Herbsttag, fragte er zum Fenster hinein, ob sie ihm einen Kaffee machen könne. Lachend erwiderte sie, ausnahmsweise, ja, aber sie sei nicht seine Serviertochter.
Seither kam Max jeden Morgen. Er plauderte mit ihr, und Frau Studer reichte ihm in einer Plastiktasse dampfenden Kaffee durch den Fensterrahmen. Sie bewunderte sein ungestümes und doch so zielstrebiges Wirken, staunte, mit welcher Fertigkeit er immer tiefere Löcher grub (insgeheim verglich sie ihn mit einem Maulwurf), mit welch' atemberaubender Schnelligkeit er sein Raupenfahrzeug knapp an den Abhängen vorbei zu den Lastwagen steuerte und seine Fracht mit subtilen Hebelbewegungen auf die Ladepritschen kippte, die Erde mit der Riesenschaufel noch zusätzlich tätschelte, bevor die schweren Autos davonfuhren. Max schien der König der Baustelle zu sein, aber er erinnerte sie auch an ein Kind, das im Sandkasten spielte. An späten Nachmittagen, nachdem er dem Bagger entstiegen war, betrachtete er händereibend und vergnügt vor sich hinpfeifend sein Tagewerk. Er öffnete eine neue Flasche Bier, einen Schoppen, den er auch während der Arbeit oft in der linken Hand hielt und an dem er von Zeit zu Zeit genüsslich nuckelte.
Eines Abends, es war tiefer November und draussen kalt und bereits dunkel, klopfte Max ans Bürofenster. Frau Studer öffnete es, und er fragte, ob sie am nächsten Wochenende schon etwas vorhabe. Nein, log sie; sie hatte beabsichtigt, einen Teppich zu kaufen und Vorhänge zu nähen. Am Freitagnachmittag nahm sie frei, und sie fuhr mit Max in eine für sie fremde Stadt. Hinter einer fahlen Nebeldecke hing die Sonne tief und bleich am blassgrauen Himmel; es schien, als ob sie erfroren wäre: Nicht einen Schimmer von Gelb oder Rot schien sie auszustrahlen. "Bleich wie der Mond", meinte Max, als er Frau Studers Staunen bemerkte.
Mit geheimnisvollem Lächeln führte Max Frau Studer in eine von gigantischen Scheinwerfern beleuchtete Riesenhalle, wo auf einem Holzoval buntgekleidete junge Männer auf Zweirädern um die Wette flitzten. Frau Studer versuchte, sich die Gesichter der Rennfahrer zu merken, aber mit den Sturzhelmen glichen sie einander. Max war besorgt, ihr die Regeln des Rennens zu erklären und den einen oder anderen der Akteure nahezubringen, und schliesslich erzählte er, einst habe er selber Velorennen gefahren, auch Siege gefeiert. Er bemühte sich um den Nachschub von Essen und Getränken, was Frau Studer zur Bemerkung veranlasste: "Du verwöhnst mich", aber Max witzelte: "Ich versuche, dir zu imponieren", und er stellte ihr ehemalige Radsportkameraden vor.
Am nächsten Montagmorgen hatte der Reif die Erde überzogen, und dichter Nebel verschleierte die Baustelle. Wegen der schwierigen Sicht wurde mit Lichtern gearbeitet. Frau Studer sass am Computertisch und starrte wie ein Fisch im Aquarium durchs Fensterglas. Der Bagger war in die Tiefe gekippt. Als man den schwer verletzten Max in den Krankenwagen trug, umklammerte seine linke Hand immer noch den Bierschoppen. In der Mittagspause eilte Frau Studer ins Kantonsspital. Max war nicht mehr zu sprechen. Kurz nach der Einlieferung in die Notfallstation sei er gestorben, bedauerte der diensttuende Arzt; niemand habe es verhindern können.
Die von Max gegrabenen Erdlöcher sind inzwischen mit drei grossen Mehrfamilienhäusern ausgefüllt worden. Zwischen den Blöcken wurde Rasen angesät; dort hat man Spielplätze eingerichtet. In den Sandkästen tummeln sich nun Kinder, die Löcher graben, Plastikeimer füllen und kunstvolle Sandhaufen mit farbigen kleinen Schaufeln sorgsam tätscheln. Darumherum kreisen kleine Rennfahrer auf ihren Drei- und Zweirädern.
Frau Studer betrachtet die Spiele durchs Bürofenster. Im glitzernden Schein der Nachmittagssonne versickert die Wirklichkeit.
PSYCHIATRIEGESCHICHTEN
Intervention eines Erleuchteten
Von Felix Feigenwinter
Um zu seiner Psychotherapeutin zu gelangen, musste Sebastian den Fluss überqueren, der die Stadt in zwei Teile trennt. Die Psychiaterin, eine feine Person, mit der er kultivierte Gespräche führte, wohnte zwar im Stadtteil, wo auch Sebastian domiziliert war, doch hatte sie vor einiger Zeit die Praxis eines Kollegen übernommen, der Opfer eines Verkehrunfalls geworden war. Ein Auto hatte den Velo fahrenden Arzt, der zur Arbeit radelte, gerammt und auf die Strasse geschleudert. Dabei verletzte sich der Psychiater (der keinen Sturzhelm trug) so schwer am Kopf, dass er das Unglück nicht überlebte.
Während der Fahrt über die Brücke erlebte Sebastian Seltsames: Als er aus dem Tramfenster auf den breiten Fluss hinaussah, erspähte er in der Ferne des nordwestlichen Horizonts die strahlende Morgensonne. Das war sehr wundersam, denn es war wie gesagt Morgen, viertel vor zehn, wie Sebastian mit Blick auf seine Armbanduhr feststellte, und er nahm selbstverständlich an, dass die Sonne auch heute im Osten aufgestiegen sei; warum also erschien sie, so früh am Tag, bereits in der entgegengesetzten Himmelsrichtung, zudem über dem Hochkamin der städtischen Kehrichtverbrennung, wohin sie sich noch nie verirrt hatte, übrigens auch abends nie, wenn sie sich, weiter im Westen, den Blicken zu entziehen begann? Irritiert wandte sich Sebastian von der rätselhaften Erscheinung ab und spähte in die andere Richtung aus dem Nachbarfenster flussaufwärts, und siehe da: Auch hier stand der Feuerball am heiterblauen Himmel, am südöstlichen Horizont! Allmählich begriff Sebastian, dass er eine Täuschung erlebte: Die Morgensonne schien durchs südöstliche Fenster und spiegelte sich in der nordwestlichen Glasscheibe, die den Blick auf den Hochkamin der Kehrichtverbrennungsanstalt freigab, so dass der Fahrgast den Eindruck erhielt, er würde gleichzeitig von zwei Sonnen bestrahlt. Diese Erklärung befriedigte Sebastian intellektuell, beruhigte seine Vernunft, aber er stellte fest, dass seine Gefühle von der Ernüchterung unberührt blieben: Das Erlebnis, von zwei Sonnen gleichzeitig beschienen worden zu sein, erfüllte ihn mit einer Wärme und Stärke, wie er sie in seinem bisherigen Leben noch nie gespürt zu haben glaubte.
Als er zehn Minuten später vor dem Haus stand, wo die Psychotherapeutin praktizierte, war er zuversichtlich, dass er sich dieser Dame, deren einfühlsame, warmherzige Art er so sehr schätzte und für die er dankbaren Respekt empfand, sich heute besonders würdig erweisen könnte, denn er empfand zum erstenmal, seit er sie regelmässig besuchte, jene Ausgeglichenheit und Ruhe, die er sich immer gewünscht hatte, um der liebevollen Zuwendung seiner Therapeutin zu entsprechen. Zwar hatte er sich stets bemüht, die Aerztin, die seine Seelenschmerzen so wohltuend zu lindern verstand durch ihr aufmerksames Zuhören, ja durch ihre blosse Anwesenheit, vor Einblicken in die düsteren Abgründe seiner Seele zu verschonen; stets war er besorgt, den netten Gesprächsstil aufrechtzuerhalten, und er vermied es, die höflichen Umgangsformen und die angenehme Atmosphäre durch finstere Andeutungen oder gar Ausbrüche der Verzweiflung zu zerstören. Heute nun, so schien ihm, würde ihm das leicht gelingen, denn er fühlte sich sonderbar erleuchtet.
Wie immer bei seinen Besuchen öffnete die Psychiaterin die Haustür, indem sie den automatischen Türöffner mit Druckknopf von der Praxis aus betätigte, nachdem Sebastian draussen geläutet hatte, und sie blieb vorerst auch unsichtbar, nachdem er ihr Reich im zweiten Stockwerk durch die offene Praxistür betreten hatte. Nun wusste er, dass er sich ins Wartezimmer zurückzuziehen hatte, da ein anderer Patient die Therapeutin noch davon abhielt, sich dem Neuankömmling schon widmen zu können. Die Tür des Warteraums stand wie immer weit offen, was normalerweise keine Beeinträchtigung der Diskretion bedeutete, da sich zwischen diesem Zimmer und dem Therapieraum noch eine Bürokammer befand, wo die Aerztin ihre administrativen Arbeiten erledigte, und ausserdem die Toilette, die Sebastian bisher nie benützt hatte.
Heute aber drang eine laute, unheimlich zornige Männerstimme aus dem Sprechzimmer. Sebastian hörte, wie dieser erregte Kranke die Frau Doktor mit ungehemmter verbaler Gewalt attackierte, sie als "verdammte Hure" beschimpfte und ihr drohte, sie umzubringen. Warum, fragte sich Sebastian mit wachsendem Entsetzen, empfing sie solche aggressive Grobiane, da sie sich doch ohne Arztgehilfen, der den Leibwächter hätte spielen können, ungeschützt in ihrer Praxis aufhielt? Da sich der Unbekannte keineswegs zu beruhigen schien, sondern seine Drohungen mit anschwellendem Geschrei wiederholte, entschloss sich Sebastian, der Therapeutin zu Hilfe zu eilen. Mit einer Entschlossenheit, die ihn nachträglich selber verwunderte, stürmte er aus dem Wartezimmer zur Sprechzimmertür, hinter der die unerträglichen Verbalattacken des tobenden Patienten unvermindert anhielten, und er klopfte energisch an die Tür. Der Wüterich verstummte, und da Sebastian von der Aerztin keinen Laut vernahm, was ihn zu den schlimmsten Befürchtungen veranlasste, riss er die Türe auf. Die Aerztin sass hilflos in ihrem Therapeutensessel, derweil der Tobian, ein grobgliederiger, knochiger, bärtiger Riese, mitten im Raum stand, mit langen Armen herumfuchtelte und seine grossen, robusten Hände schliesslich zu einem Würgegriff formte, als ob er auf die Verängstigte sogleich wie ein wildes Tier losspringen wolle. Sebstian stellte sich dazwischen. "Halt!" herrschte er den Unzurechnungsfähigen an, "schämen Sie sich nicht!? Diese Dame will Ihnen helfen, aber Sie beschimpfen und bedrohen sie! Pfui! Ihr Verhalten ist unwürdig und unehrenhaft! Als Herkules sind Sie verpflichtet, die Dame zu beschützen!"
Sebastians Intervention ermöglichte der Therapeutin, in den Nebenraum zu flüchten und Alarm zu schlagen. Nachdem zuerst zwei uniformierte Polizisten die Praxis betreten hatten und etwas später die Ambulanz eingetroffen war (im Gegensatz zum feingliederigen Sebastian, der sich als Bodyguard schlecht eignete, ebenfalls zwei kräftige Männer), wurde der wilde Mann wegtransportiert. Im Bestreben, seiner Therapeutin nach der überstandenen Aufregung nun etwas Ruhe und Erholung zu gönnen, und weil er glaubte, die Zeit seiner Therapiestunde sei inzwischen abgelaufen, verabschiedete sich Sebastian, ohne von seinem Erlebnis auf der Brücke mit den zwei Sonnen erzählt zu haben, was er sich eigentlich vorgenommen hatte.
Erst als er, ein heiteres Liedchen vor sich hinpfeifend, durch das Spätmorgenlicht zur Tramhaltestelle schlenderte, fiel ihm ein, dass er vergessen hatte, sich einen Termin für die nächste Sprechstunde geben zu lassen. Und er fragte sich, ob ihm die Aerztin für seinen heutigen Besuch auch eine Rechnung schicken würde, obwohl sie mit ihm gar kein Therapiegespräch geführt hatte. Aber das würde sich klären. „Kommt Zeit, kommt Rat“, sagte er vor sich hin, als er das Tram bestieg, momentan zufrieden mit sich selbst und der Welt und glücklich darüber, dass er der verehrten Dame einen Dienst hatte erweisen dürfen.
Familienausflug
Von Felix Feigenwinter
Herr und Frau Busenhart unternehmen einen Sonntagsausflug mit ihrer einzigen Tochter Monika, die seit dem Tod ihres Kindes aus der elterlichen Wohnung ausgezogen ist. Die kleine Familie wandert nach einer stummen Kletterei über einen steilen Waldweg an weidenden Kühen vorbei über eine ungewöhnlich weite, von Sonnenlicht überflutete Hochebene, über die ein kühler Wind weht. Während einer Rast in einem Bergrestaurant entnimmt Monika ein gelbes Päcklein ihrer Ledertasche, die sie von der Mutter zu Weihnachten geschenkt bekam, und zieht daraus eine Zigarette, die sie sich zwischen die Lippen klemmt. „Muss das sein“ tadelt der sonst schweigsame Vater, „nur infantile Leute stecken sich Sargnägel in den Mund!“ – „Wisst ihr eigentlich, wie alt ich bin?“ schreit nun die Tochter. - „Zu alt, um pubertär zu reagieren“, antwortet der Vater trocken.
Auf der Heimfahrt, in einem von rucksacktragenden Wanderern überfüllten Eisenbahnwagen, erlebt die Tochter, wie der Vater einen kleinen kläffenden Hund zurechtweist, den er, mit schriller Stimme, als „unerzogen“ beschimpft. Die Dame, die das Tier an einer Leine hält, fragt er, ob sie einen Waffenschein besitze. Die Hundebesitzerin zeigt sich gekränkt; offenbar erteilt sie dem Tier nun heimlich den Befehl, in des Vaters rechte rote Wollsocke zu beißen, was diesen veranlasst, mit seinem Spazierstock gegen den Hund zu sticheln. Die Dame bezeichnet Herrn Busenhart als „ordinären Menschen“, und einige der übrigen Fahrgäste beginnen zu tuscheln.
In der Halle des Hauptbahnhofs, in den der Zug einfährt, erheben sich die Ankömmlinge mit steifen Blicken. In Einerkolonne verlassen sie den Eisenbahnwagen, in einen Menschenstrom eintauchend, der sich anarchisch durch die Bahnhofskanäle wälzt. Draußen sondert sich Monika fast wortlos von ihren Eltern ab und eilt zu ihrer Zweizimmerwohnung. Sie wird, wie oft um diese Zeit, von Störchen überholt, die entlang der Strasse wenige Meter über der elektrischen Tramleitung dem zoologischen Garten zustreben. Vor dem Haus bleibt Monika stehen und sieht einen Schwarm Krähen, der nordwärts zieht. Sie wartet und stellt sich vor, einer der schwarzen Vögel würde zu ihr herunterstürzen, um ihr eine Botschaft ins Ohr zu krächzen. Es geschieht aber nichts dergleichen; der Schwarm flattert hoch über den Dächern den Bergen zu. Endlich in der Wohnung angekommen, zieht sich Monika sogleich ins Schlafzimmer zurück, wo sie sich schnell entkleidet und erschöpft aufs Bett fällt. Das kräftige spitze Messer kommt ihr in den Sinn, das noch im ersten Besteckfach in der obersten Küchenschublade liegt. Es wäre an der Zeit, es verschwinden zu lassen; vielleicht wirft sie es morgen auf dem Weg ins Büro in den Fluss.
Sie steht an einem Dachfenster und sieht in einen Garten. Es ist Abend. Die alte Frau, die im Garten an einem Tisch sitzt, droht in der Dämmerung zu versinken. In der Ferne geistern zwischen Baumgerippen Lichtkolonnen. Die alte Frau erhebt sich, reckt den Kopf und verharrt lauschend. Auf einmal beleuchtet grelles Scheinwerferlicht den Kiesweg, die Grasmatte schimmert; Monika hört im Traum Kies knirschen. Die alte Frau zeigt mit ausgestrecktem Arm gegen den in den Garten rollenden Wagen. Auf dessen Kühlerhaube liegt ein blutverschmiertes Kind, ein schwerverletztes oder totes Mädchen, das wie eine Trophäe in den Garten geschoben wird. Monika schreit – und erwacht.
Während Wochen schlitzte Monika mit dem Messer, das sie in einem Warenhaus günstig erworben hatte, die Pneus parkierter Autos auf. Ihre triebhaften, scheinheiligen Abendspaziergänge entlang verschiedener Parkplätze hatte sie ihrem Psychiater anvertraut, und dieser warnte sie: „Damit zerstören sie sich selbst!“ Die Zeitungen berichteten von „Vandalenakten“; in Leserbriefen schworen aufgebrachte Autobesitzer Rache. Aber niemand konnte das Pneustechen verhindern, geschweige denn Monika als Täterin entlarven. Die Eltern verhalten sich ahnungslos.
Inzwischen ist sie zur Ruhe gekommen. Sie hat die Zerstörung des Kindes gerächt. Traum und Wirklichkeit zerflossen. Nur ihr Psychiater weiß Bescheid; im Schutz seines Arztgeheimnisses wähnt sie sich geborgen.
Besuch in einer Klinik
Von Felix Feigenwinter
An jenem Morgen hätte Mirjam von der Klinik aus zur Arbeit gehen sollen; eine Sozialarbeiterin hatte ihr eine Halbtagsbeschäftigung im Büro eines Museums vermittelt, aber ein erneuter Ohnmachtsanfall mit schweren Herz-Kreislaufstörungen hatte sie ans Bett gefesselt. Als Mirjams Mutter das Zimmer betrat, in dem sich die Tochter seit mehreren Monaten betreuen ließ, traf sie diese schlafend. Sie zog das mitgebrachte Geschenk aus einer Plastiktüte und hängte den kornblumenblauen Rock über die Lehne eines der beiden Stühle im Zimmer. Etwas später erwachte die Patientin und verwechselte den Besuch vorerst mit einer Arztvisite; allmählich dämmerten ihr die Zusammenhänge.
"Möchtest du wieder nach Hause?" fragte die Mutter wie beiläufig.
Ihr Zuhause sei woanders, antwortete die Tochter mit unerwartet klarer Stimme, und ihr verschleierter Blick schien durch das Fenster über eine alte Eibe zu schweifen, die am Rande des großen Gartens im Schatten eines Kastanienbaums stand.
Ob sie das blaue Kleid gesehen habe, erkundigte sich daraufhin die Mutter, und sie nannte den Ort, wo sie das Geschenk gekauft habe, und die Tochter lächelte matt.
"Du warst im Büro so tüchtig", flüsterte die Mutter, "aber du bist empfindlich!"
Hierauf ließ sie sich zeitungslesend in einer Ecke des Zimmers am Fensterplatz nieder. Nun betrat ein jüngerer Mann das Krankenzimmer, wo unerwartet still die Besucherin im Sonnenlicht am Fenster saß. Sie berührte die entgegengestreckte Hand nur kurz.
"Freut mich", sagte sie, doch ließ sie es nicht dabei bewenden, sondern fragte, als sich der Schnurrbärtige zum Bett zurückziehen wollte:
"Wer sind Sie?"
"Er ist der Arzt", betonte Mirjam, "Herr Doktor Opferkuch."
Der Mann mit dem Zwirbelschnauz bekräftigte: "Ich bin der Arzt."
Die Tochter erwähnte, dass er eben nicht wie andere im weißen Kittel auftrete, und die Mutter schloss daraus, dieser Umstand erfülle ihn mit Stolz.
"Es mag fortschrittlich sein", räumte sie ein, "für die Besucher ist es verwirrend."
Der Schnurrbärtige verhielt sich so, als habe er es überhört. Er fragte die sich seitwärts aufrecht stützende Tochter, ob die Tabletten schon wirkten, wobei er, so dünkte es die Mutter, auf eine Antwort ebenso Wert zu legen schien, wie er auf sie zu verzichten wünschte. Er sei übers Wochenende abwesend, stellte er in Aussicht, statt seiner würde dann eine Frau Rebhuhn (oder ähnlich) auftreten.
Nachdem der Mann das Zimmer verlassen hatte - nicht ohne Mirjam eingeschärft zu haben, Besuche jederzeit abzulehnen, falls sie sie nicht wünsche (was die Tochter zur lebhaften, jedoch kraftlosen Beteuerung veranlasste, die dort sitze, sei ihre Mutter), trat diese ans Bett der Kranken und erwähnte, ihr Hausmitbewohner sei letzte Woche gestorben. "Er war ein enttäuschter Idealist, betonte sie, ich glaube, er ist an Enttäuschung gestorben."
"Was ist mit seiner Frau?" versuchte Mirjam nun zu erkunden.
"Sie spricht seit einiger Zeit nicht mehr", antwortete die Mutter, "man hat sie ins Pflegeheim gebracht."
Hierauf fiel die Tochter ins Kissen zurück und starrte zur Decke. Dabei veränderte sich ihr Gesicht in einer Weise, wie die Mutter es noch nie erlebt hatte.
Die Mutter verließ das Zimmer, schritt durch einen schmalen Gang in den Klinikgarten und näherte sich schreienden Vögeln und geheimnisvoll lächelnden Patienten. Wenig später bestieg sie einen Bus, der sie an eine andere Peripherie der Stadt bringen sollte.
Mit aufgerissenen Augen suchte Mirjam die Wand ab. Sie fand das Plakat, das ihr vor einiger Zeit ein Herr Mors geschenkt hatte. Mit ausgeschnittenen, aufgeklebten Buchstaben hatte Mors die Wörter "wirklICHkeit nICHts" aneinandergereiht, eine magische Folge, die sich wie zufällig ergeben hatte, die aber - daran glaubte auch sie - wahrer schien als die Antworten, die sie während der Therapiegespräche auf die Fragen der Therapeuten zu äußern versuchte.
Mirjam kuschelte sich zur Seite und spürte, wie die Dämmerung sie zu umhüllen begann. Sie wiegte sich in den Wunsch, aus der wirlICHkeit zu erwachen, ins nICHts zu entschweben, in einen nicht gebärenden Mutterschoss, der die Auflösung beschleunigt und sanft verbirgt. Bevor sie das Bewusstsein ganz verlor, erspähte sie die dunkle Gestalt einer Katze, die täglich übers Fenstersims vor ihrem Zimmer strich. Gebannt nahm sie wahr, dass das Tier eine Amsel in der Schnauze trug. Mit letzter Konzentration versuchte sich Mirjam das allmähliche Verstummen der Vogellieder aus dem Klinkgarten vorzustellen. Indessen begannen andere Geräusche die einsetzende Stille auszufüllen: hemmungsloses Fauchen und die unverschämt deutlichen Stimmen klagender Säugetiere, schauerlich wie das nächtliche Heulen aus den Familienblöcken am Rande der Stadt.
Die Lesung
Von Felix Feigenwinter
"Ich habe die Tendenz, zu verschwinden", hatte er ihr gesagt, und weil er es im Zusammenhang mit seiner Ehescheidung erwähnte, fragte sie ihn, ob er Zyniker sei. "Nein", antwortete er dezidiert, "ich leide. Ein Psychiater sagte mir: 'Sie reiben sich an der Realität'. Damit hat er die Problematik natürlich verniedlicht. Aber das tun alle Psychiater."
Fabian hatte sie mehrere Wochen nach ihrer Einweisung in die Psychiatrische Klinik im Patientencafé kennengelernt. Er erzählte ihr von seiner Angst, in der Wohnung im elften Stock eines Hochhauses sterben zu müssen, in die er kurz nach seiner Verehelichung eingezogen sei. Nicht vor seinem Tod an sich habe er sich gefürchtet, oh nein, der ängstige ihn nicht. Gepeinigt habe ihn die Vorstellung, sein Leichnam hätte vom elften Stockwerk zur Erde getragen werden müssen. Da er seit langem herzleidend sei und zudem an Asthma leide, habe er sich nur noch durch den Auszug aus dieser Wohnung retten können. Seine Frau habe ihm die Flucht übel genommen.
"Die Scheidung wäre vielleicht zu vermeiden gewesen, wenn Sie in eine Parterrewohnung umgezogen wären?" erwog die Zuhörerin.
"Möglicherweise", überlegte nun Fabian, "das Problem war doch, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie man mich durch das viel zu enge Treppenhaus an den kurzen Ecken vorbei hätte hinunterschaffen sollen. Und der Transport im Lift war noch unvorstellbarer. Der Lift war so eng, dass nicht einmal zwei vollschlanke Erwachsene darin unbedrängt Platz gefunden hätten, geschweige denn ein auf einer Bahre ruhender Toter. Es war für mich eine Zumutung von Würdelosigkeit, der ich mich entzog."
"Wie hat Ihr Psychiater darauf reagiert?" fragte die Zuhörerin.
"Der meinte kühl, Leichen aus einem Hochhaus könnten an der Fassade abgeseilt werden. Was soll's?" seufzte Fabian, "inzwischen habe ich mich damit abgefunden, dass Psychiater gar nicht wirklich zuhören. Trotzdem las ich ihm eine Geschichte vor, die ich vor einigen Jahren geschrieben habe."
Ob er denn Schriftsteller sei, wollte die Zuhörerin nun wissen.
"Nicht eigentlich", erklärte Fabian; als junger Mensch habe er, nachdem er eine kaufmännische Lehre beendet habe, während vier Jahren in einer Speditionsfirma gearbeitet; doch das sei nicht gut gegangen. Nach einem halbjährigen Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik habe er die Matura nachgeholt, habe Philosophie zu studieren begonnen und dazwischen immer wieder als Aushilfe in einer Zeitungsredaktion gearbeitet; da habe man ihn für Vertretungen von Militärdienst leitenden Korrektoren und Redaktoren gebraucht. Aber seit langem sei er arbeitslos, und heute lebe er von einer Invalidenrente.
Er musterte sie mit seinem traurigen Reptilienblick, und mit heiserer Stimme fragte er, ob sie die Geschichte hören wolle.
Die Frau bejahte, denn plötzlich war ihr abenteuerlich zumute.
Mit geducktem, ruckartigem Gang verschwand Fabian aus dem Café, um nach wenigen Minuten zurückzukehren, ein mit nervöser Schrift bekritzeltes Toilettenpapier in der Hand schwenkend.
Die Geschichte, die er seiner Zuhörerin vorzulesen begann, hörte sich verständlich an. Sie handelte von einer Frau, einer "unauffällig gekleideten, eher schmächtigen Besucherin unbestimmten Alters", wie es der Autor akribisch formulierte, "die auf dem Quartierspolizeiposten erschien, wo sie vorsichtig belächelt, väterlich ermahnt und endlich, als ihr eindringlicher Redefluss dennoch nicht versiegen wollte, energisch zurechtgewiesen wurde. Eine Anzeige sei in ihrem Fall nicht möglich, erklärten die Polizeimänner im Chor", las Fabian mit leise bebender Stimme, "die Beweislast blieb unberücksichtigt, die vorgelegten Zeitungsartikel wurden nur flüchtig beachtet; die Tonbandaufnahmen mit Reden von Weltpolitikern und Militärstrategen fanden kein Gehör. 'Sie ist verwirrt', entschied der Postenchef, und statt Anstalten zu treffen, die zur Verhaftung von Tätern geführt hätten, begleitete ein Polizist die Aufgebrachte in die Psychiatrische Klinik."
An dieser Stelle sah Fabian vom Toilettenpapier auf und musterte seine Zuhörerin grüblerisch. Diese senkte den Blick, weil sie dachte, jetzt will er mir vielleicht meine eigene Geschichte erzählen, und das stimmte sie verlegen. Doch Fabian vertiefte sich erneut ins Manuskript und fuhr fort:
"Dort wurde sie mit einem anmutig schmunzelnden, älteren Herrn zusammengeführt, den man ihr als 'Doktor Friedli' vorstellte, und diesen versuchte sie von der Berechtigung ihrer Anklage zu überzeugen. 'Sie haben vollkommen recht', meinte Doktor Friedli, indem er seinen leicht schiefen Krawattenknopf gelassen zurechtdrückte, 'die Leute, die uns mit Massenvernichtungswaffen bedrohen, sind eigentlich Kriminelle.' - 'Aber sagen Sie doch', insistierte die Frau, 'wo finden wir die Richter, die den Mördern das Handwerk legen?' - Doktor Friedli rieb sich die Hände, schaukelte den Kopf und diagnostizierte versonnen: 'Sie reiben sich an der Realität, gute Frau; ich kann Ihnen nur empfehlen, dem Zivilschutz beizutreten.' Die Frau bedankte sich und verließ die Klinik. Zuhause meldete sie sich bei der örtlichen Zivilschutzorganisation, und ihr gestörtes Verhältnis zur Wirklichkeit begann sich zu klären. Bereits im Einführungskurs, wohin sie nach einigen Monaten einzurücken hatte, hörte sie, die Pulverisierung von Menschen sei auch in Schutzanzügen und Zivilschutzkellern möglich im Falle eines Nuklearangriffs, auf den es sich vorzubereiten gelte. Der Kursinstruktor, ein flotter jüngerer Mensch, beruhigte indes, es gäbe auch durchaus friedliche Störfälle, auf die einzustellen sich lohne. Hierauf ergriff der Instruktor eine Schutzmaske und stülpte sie sich übers Gesicht; alsdann forderte er die Kursteilnehmer auf, es ihm gleichzutun."
Fabian legte das Toilettenpapier auf das Kunststofftischchen und schnappte nach dem letzten Schluck Kaffee.
"Ist die Geschichte zu Ende?" fragte die Zuhörerin unsicher.
"Nein", sagte Fabian, "wollen Sie den Schluss auch hören?"
"Ein Happy-End?"
"Das wäre wohl Kitsch", meinte Fabian, und er sah wieder auf das zerknitterte Toilettenpapier und las:
"Schon kurze Zeit danach erreichte die Frau das Aufgebot zu einem Weiterbildungskurs. Es war ein bewegter Samstagmorgen. Die Frau saß in der Küche ihrer Mietwohnung im elften Stock eines Hochhauses am Stadtrand. Soeben hatte eine Stimme am Radio die Zehn-Uhr-Nachrichten verlesen. Die Frau las das Aufgebot wie abwesend; dann faltete sie das Papier zu einem Spielzeugflugzeug und trat damit auf den Balkon, wo sie es dem Wind überließ. Inmitten von wild aufgewirbelten Baumblättern schoss es in die Weite Es verstrichen nur wenige Sekunden, bis die Frau aufs Balkongeländer kletterte. Unbeachtet von den in ihre Wohnungen verkrochenen Nachbarn fiel sie in die Tiefe. Sie stürzte schnell und leicht, und ihr Rock flatterte wie eine Fahne im Wind. Doch nun hob ein Sturm an. Blumentöpfe zerbrachen, und vielerorts klirrte Glas."
Sichtlich erschöpft von der Anstrengung des Vorlesens versorgte Fabian das Toilettenpapier in seiner Kitteltasche, und danach erhob er sich, zitternd wie ein Greis, und verließ das Café ohne hörbaren Gruß.
Der Verrat
Von Felix Feigenwinter
"Die Sachlage ist die", versuchte Herr Krebs festzuhalten, und er räusperte sich in der Mitte des Satzes, der leider nichtssagend blieb. Er ließ seinen Eröffnungsworten entsprechend seiner Gewohnheit die ebenfalls überflüssige Bemerkung "nicht wahr" folgen, eine Umständlichkeit, die sein redegewandter Gesprächspartner, Dr. Peter Wolfer, sogleich zu seinem Vorteil auszunützen verstand. So wurde Herrn Krebsens Bemühung, eine seit Jahren unausgesprochene Problematik zur Sprache zu bringen, wieder einmal im Keime erstickt, umso mehr, als Dr. Wolfer seinem Gegenüber jetzt ein Kräuterbonbon anbot. Er fischte es mit gespreizten Fingern aus einem feingeflochtenen Körbchen, das sich auf dem etwas protzigen Präsidentenschreibtisch hinter den sich wild auftürmenden Aktenbergen wie etwas Fremdes, Frivoles versteckt hielt. Obwohl Herr Krebs Süßigkeiten sonst mied, bemühte er sich, der Geste seines Vorgesetzten gerecht zu werden, indem er das Bonbon beinahe feierlich in den Mund steckte. Vorsichtig lutschend schöpfte er, noch während ihn der Präsident mit einem blitzenden Redeschwall bombardierte, den Verdacht, sich versehentlich respektlos zu benehmen, da sich Dr. Wolfer doch vielleicht keinen Kanzlisten wünschte, der wichtige Anweisungen bonbonlutschend entgegennahm. Diese Vorstellung quälte ihn so sehr, dass er schließlich zum Gedanken Zuflucht nahm, Dr. Wolfer habe ihm möglicherweise das Bonbon angeboten in der Absicht, ihm damit den Mund zu stopfen.
Wenig später verließ Herr Krebs das Büro des Präsidenten korrekt, mit einer leichten Verbeugung (die Dr. Wolfer für lächerlich, wenngleich angemessen halten mochte), innerlich jedoch blutete er; sein frisch verwundeter Stolz, seine zerknirschte, in heillosem Groll bebende Seele verdunkelte seinen Gang zurück in die von einem grauen Montagmorgen fahl erleuchtete Kanzlei. Dort ging er eine Zeitlang stumm auf und ab, bis ihn das Schrillen des Telefons erschreckte. Innerlich immer noch bebend riss er den Hörer ans Ohr; er hörte eine Frauenstimme, es war Frau Wolfer, die Gattin des Präsidenten, die mit ihrem Mann sprechen wollte, wie oft schon hatte er diese Verbindung hergestellt, ohne seine wahren Gefühle zu offenbaren; zum erstenmal verstellte er sich nicht. "Ich kann nicht verbinden", schrie er mit anschwellender heiserer Stimme, "der Präsident ist tot. Ich habe ihn getötet". Jetzt war es ausgesprochen.
In die nun folgende furchtbare Stille drang sein eigener schwerer Atem aus der Hörmuschel, dann vernahm er wieder Frau Wolfers Stimme, die nun ebenfalls so angstvoll wie schneidend tönte: "Herr Krebs, sind sie in der Kanzlei?" Herr Krebs antwortete tonlos: "Er ist tot. Ich habe ihn umgebracht. Soeben."
Hierauf legte er den Hörer zurück auf den Apparat und setzte sich an sein Arbeitspult. Er sah auf die Kanzleiwand, wo früher Gerichtswitze hingen, aus Zeitungen ausgeschnitten, die sein längst pensionierter Vorgänger gesammelt und aufgehängt hatte. Dr. Wolfer hatte ihre Beseitigung verfügt, da in einem öffentlich zugänglichen Amtsraum, wie er erklärte, keine Karikaturen zu dulden seien. So blieb als einzige Belebung an der Wand ein Gemälde, eine Leihgabe des kantonalen Kunstkredits, wie die Aufschrift auf dem Schild am Rahmen des Werks verriet. In der ersten Zeit seines Kanzleidaseins hatte Herr Krebs befürchtet, das Bild würde ihm entführt, etwa im Zusammenhang mit einer Museumseröffnung, oder weil ein hoher Chefbeamter die Gabe im eigenen Büro aufgehängt wissen mochte. Mit den Jahren lernte er, diese Angst zu bezähmen. Das Bild war mittlerweile Bestandteil seiner Seele geworden; es begleitete ihn über Mittag, wenn er in einem kleinen Restaurant in der Nähe einen Imbiss zu sich nahm, und abends in seine Junggesellenwohnung am Stadtrand. Die freien Wochenübergänge und die Ferien verbrachte er selten auswärts, da er sich in der Stadt wie ein Fötus eingenistet hatte. Jede Verpflanzung, auch nur eine vorübergehende, gefährdete sein Gleichgewicht. Die Kanzlei im Stadtzentrum war zu einem Tabernakel geworden; schon in seiner eigenen Wohnung an der Peripherie fühlte er sich wie abgeschoben, verloren. Unauffälliger Kontakt zu Andrea, der Gattin des Präsidenten, war ohnehin nur in der Kanzlei möglich, durchs Telefon, wo er die Stimme dieser wunderbaren Frau, die er mit den Jahren wie eine Ikone verehrte, mit der Stimme des Präsidenten verband. Frau Wolfer nannte er nur ganz heimlich, in flüsternden Monologen, "Andrea"; es ihr einzugestehen war nicht vorgesehen, ja, Herr Krebs hätte es für überflüssig gehalten, da sie in seinen Vorstellungen doch davon wusste!
Wenn sie - selten genug - in der Kanzlei erschien, um ihren Gatten abzuholen, fühlte Herr Krebs ihren geheimnisvoll-leuchtenden, sanft wissenden Blick auf sich ruhen. Diese naturhaft-schöne, herbe Dame erinnerte ihn manchmal nebelhaft an seine zu früh verstorbene Mutter, die ihn von seinem Vater weggenommen hatte, einem kalten, beziehungsarmen Mann, der nach dem Tod der geschiedenen Gattin, als man den Sohn ins Waisenhaus brachte, aus der Stadt zog und sich nicht mehr sehen ließ. Kurz vor der Scheidung war Mutter noch aus der Kirche ausgetreten; Herr Krebs vermutete, um den Vater zu ärgern, der für einen Verein der Pfarrei die Buchhaltung führte. Obwohl Herr Krebs die kirchliche Welt, zu der sein Vater gehörte, bewusst ablehnte (schon um vermuteten Vorwürfen des Vaters zu begegnen, der frühe Tod der Mutter sei gewissermaßen eine Strafe für den Kirchenaustritt gewesen), spürte er einen Zusammenhang zwischen seiner früheren kindlichen Andacht zur Mutter Gottes Maria in der Kirche und seinem heutigen mystischen Verhältnis zu "Andrea".
Auf dem Gemälde an der Kanzleiwand schien diese Beziehung festgehalten. Man sah ein Liebespaar. Die Geliebte (sie glich "Andrea" auch äußerlich, wie Herr Krebs fand) hielt den Kopf des Geliebten wie eine Mutter an ihre Brust. Das Bild war eigentlich schlecht geeignet für eine Gerichtskanzlei; der längst verstorbene frühere Präsident, Dr. Wolfers Kunst liebender Vorgänger, hatte es ausgesucht. Als später Dr.Wolfer das Amt antrat, blieb das Gemälde, entgegen den Befürchtungen von Herrn Krebs, hängen, wahrscheinlich weil es, im Gegensatz zu den Gerichtswitzen des früheren Kanzlisten, von einer offiziellen staatlichen Institution, dem Kunstkredit, geliehen war. Herr Krebs war aber sicher, dass Dr. Wolfer der Sinn für die dargestellten Zärtlichkeiten abging; er hielt ihn für einen unsensiblen, oberflächlichen Mann, der auf äussere Machtentfaltung bedacht war. Die phantastischen Dimensionen, welche Gewähr für Herrn Krebsens Verbindung zu „Andrea“ boten, blieben dem Präsidenten gewiss verschlossen.
Herr Krebs wusste nicht, wie lange er sinnierend am Pult gesessen hatte, als er Lärm hinter der Kanzleitür hörte, aufgeregte Stimmen, ein wüstes Gepolter; fast gleichzeitig stürzten Uniformierte herein, Herr Binggeli und Herr Furrer, Polizeibeamte, die manchmal Schwerverbrecher zu den Gerichtsverhandlungen geleiteten. Im Türrahmen sah er nun auch Dr. Germann, den zweiten Staatsanwalt, dahinter, wie versteckt im Dunkel des Ganges, Frau Wolfer.
"Andrea!" rief Herr Krebs und stürzte an den Polizisten vorbei durch den Türrahmen, vorbei am verdatterten Doktor Germann, vor Frau Wolfers Füße, die er zu küssen versuchte, was ihm nicht gelang, da Frau Wolfer, mit Hilfe des Staatsanwalts, ausgewichen war. Dabei entglitt ihr ein Schuh, den nun Herr Krebs, zu Boden gefallen und halb knieend aufgerichtet, wie eine Monstranz umklammerte.
"Macht diesem unwürdigen Auftritt ein Ende!" befahl der aus einem Seitengang herbeigetretene Doktor Wolfer in voller Missachtung der Bedeutung des Augenblicks in Herrn Krebsens Lebenstragödie. Als Herr Binggeli dem Kanzlisten vorsorglich die Handschellen anlegte, suchte Herr Krebs den Blick von „Andrea“. Die Dame seiner Träume hatte sich von ihm abgewandt, während der von seiner Gattin umarmte Dr. Wolfer, der Präsident, ihn keines Blickes würdigte.
"Peter", hauchte Frau Wolfer auf die Schulter ihres Gatten. - "Du hast mich verraten, Andrea", murmelte Herr Krebs, als er von Binggeli und Furrer an dem in Befremden erstarrten Paar vorbei abgeführt wurde.
(Erstmals erschienen in der Literaturzeitschrift "Poesie" 1985, Heft 2)
Der Sohn und die Freundin
Von Felix Feigenwinter
Urs erinnerte sich, als kleines Kind den Vater von einer Publikumstribüne hinunter bestaunt zu haben, wie er in einem von Männern und Frauen bevölkerten Saal durch ein Mikrophon sprach. Da er nur mit einer dünnen, hohen, leisen und immer ein wenig belegten Stimme ausgestattet war, fehlte dem Vater die natürliche Möglichkeit zu kräftigen rhetorischen Auftritten. In freien Diskussionen rang er manchmal nach Atem und passenden Formulierungen. Er schob Verlegenheitsworte ein, um Pausen zu füllen, wiederholte oft dieselben Worte, was auf einen beschränkten Wortschatz oder jedenfalls auf eine langsame, etwas schwerfällige Denkweise schliessen liess, die in Gefühlen zu schweben schien. Oft versuchte der Vater mangelnden Scharfsinn hinter zynischen Bemerkungen zu verstecken, oder er hüllte sich in Schweigen, das arrogant, verlegen oder geheimnisvoll erschien, je nachdem, welchen Gesichtsausdruck er gerade zur Schau trug. Früher, als er noch jünger gewesen sei, habe er lebhafter und phantasievoller sprechen können, hatte die Mutter einmal behauptet. Nach verschiedenen Schicksalsschlägen und auch, weil er seine Kräfte unnötig verpufft habe, sei er inzwischen beinahe verstummt, aus Enttäuschung; seine Lebenslust sei dahin.
Je älter Urs wurde und je länger er über diesen Vater nachdachte, desto mehr erstaunte ihn dessen frühere Aktivität. Inzwischen war er ein alter Mensch geworden und längst pensioniert; seine einstigen Bekannten waren gestorben oder hatten ihn fallengelassen, und in den Jahren vor seiner Pensionierung hatte er ein ziemlich unbeachtetes und abgestandenes Dasein in einem Büro verbracht. Als Rentner lebte er nun zurückgezogen im ramponierten Haus seiner Frau, die, so glaubte Urs über seine Mutter zu wissen, den Schein ehelicher Eintracht zu wahren trachtete, den Vater aber nicht wirklich liebte.
Für Urs hatte der Vater eine sozusagen grossmütterliche Ausstrahlung; er verkörperte für ihn keine männliche Kraft. Vielleicht lag das auch daran, dass die Mutter im Familienkreis früher einmal spasseshalber erwähnt hatte, der Vater sei gar kein Mann, sondern eine getarnte Frau. Die Erinnerung daran hatte Urs später verwirrt; manchmal wünschte er, die Ehe der Eltern wäre geschieden geworden. Aber dazu war es jetzt wohl zu spät, und Urs war es schliesslich doch recht, dass er, der "ewige Student", im Elternhaus zwischen dem grossmütterlichen Vater und der väterlichen Mutter wohnen durfte, irgendwie beziehungslos im Schatten der Eltern. Trotzdem hatte er seiner Freundin mit dem Bekenntnis erschreckt, er könne sich nicht vorstellen, dass seine Eltern stürben; da würde er sich zu verlassen vorkommen.
Der sanften, leicht beschwipsten, aber auch klagenden Stimme ihres Geliebten hatte die Freundin unzählige Male am Telefonhörer gelauscht. Sie hatte sich nicht satthören können. Scheinbar munter hatte sie Urs aufgefordert, nach dem Ertönen des Piepstones ihre Botschaft zu hinterlassen, und sie hatte irgendetwas Zärtliches geflüstert, mehrmals täglich, denn der Geliebte machte sich rar, besuchte sie immer seltener in ihrer kleinen Mietwohnung, legte sich nur noch unter Vorbehalten zu ihr ins Nest: immer häufiger verkroch er sich in seinem Elternhaus, um sich zu "regenerieren", wie er es nannte. Dort gab er vor, sich seinen Studien zu widmen; in Wirklichkeit lag er verloren auf seinem Bett und hörte Musik, stundenlang Mozart, Thelonious Monk, Miles Davis oder den kräftigen Gesang einer schwarzen Bluessängerin.
Doch eines Abends ereignete sich etwas Ungewohntes. Nach einem unerträglich schwülen Sommertag durchbrauste ein herbstlicher Sturm die Stadt. Als die Freundin telefonierte, erschauderte sie: Urs hatte die vertraute Tonbandstimme ersetzt. Die neue Stimme hörte sich erschreckend abweisend an, unerbittlich streng (zu streng für den zarten, klagenden Jüngling), gleichzeitig tieftraurig, hoffnungslos düster. Und sie verschwamm in den Anfangsklängen zu Mozarts Requiem, die statt des Piepstons ertönten. Die Freundin erkannte die Aufnahme: Wie oft schon hatte sie diesem himmlischen Trauerkonzert innerlich bebend gelauscht! Nun glaubte sie die Fistelstimme von Urs' Vater zu vernehmen, der irgend etwas Weinerliches zu äussern schien (vielleicht beschwerte er sich darüber, dass sich der Abschluss von Urs' Studium immer noch nicht abzeichnete?). Hierauf durchdrang ein Schrei das Requiem. Die Antwort der Mutter galt wohl dem Vater, doch für die Freundin wirkte sie wie ein Befehl an ihre Adresse: "Lass' meinen Sohn endlich in Ruhe, du machst ihn unglücklich!"
Die Worte der Mutter erschütterten das aufgewühlte Gemüt der Freundin. Sie hatte Urs in der Universität aufgespürt. Zwischen den anderen Studenten, die entschlossen den Hörsälen zustrebten, entdeckte sie einen aparten Jüngling, dessen Sensibilität sie ergriff. Aber seine verletzte Seele war versponnen mit den unglücklichen Seelen seiner Eltern; woher sollte sie, die Freundin, die Kraft nehmen, sie zu erlösen?
Das Rätsel Ottokar
von Felix Feigenwinter
Früher, als Ottokar noch Meerschweinchenzucht betrieben hatte im elterlichen Garten: die Tierchen, in der Kleinkinderschule gegen Vaters Militärmesser eingetauscht, im Komposthaufen sich königlich vermehrten, in Einerkolonne an Löwenzahn vorbei den väterlichen Salatbeeten zustrebten, wo sie für Stunden weidend verweilten, hatte er Vater wie Mutter an den Rand der Verzweiflung getrieben mit seinem Wunsch, Sträfling zu werden, was der Vater, Steuerbeamter in der siebzehnten Besoldungsklasse, empörend fand. Eine Beamtenlaufbahn war Ottokar als trüber Lebensinhalt erschienen, vorzeitige Pensionierung, Einteilung in höhere Besoldungsklassen: die häufigsten Gesprächsthemen am Familientisch, ausweglose Aussichten. In Sträflingen hingegen mussten ungeahnte Möglichkeiten schlummern: Sie lösten Furcht aus! Die Mutter hatte den Umgang mit ihnen verboten, wenn sie nach getaner Arbeit unter der Aufsicht eines blaubehosten Wärters sich stärkten in der Nähe des elterlichen Hauses; sie hegten Fluchtgedanken, hofften auf Erlösung, kämpften für Freiheit, dachte Ottokar. Ein kämpfender Beamter hingegen war absurd, ebenso Vater auf der Flucht. Der marschierte nur immer aufs Steueramt mit seiner kargen Miene, gehorsam um halb acht und mittags um halb zwei, trug keine Fluchtgedanken mit sich herum, überhaupt keine Gedanken vielleicht, ewig dasselbe trostlose Gesicht vielmehr. Manchmal begleitete ihn Ottokar auf halbem Weg, stumm, denn Vater war ein wortkarger Mann; ein tapferer, hatte die Grossmutter gesagt.
Als einmal müder Nebel über die Wiesen kroch, zog Ottokar einen Leiterwagen neben Vater her, setzte sich darein auf abfallender Strasse: glaubte, Vater würde hinten halten; sah sich um: suchte vergeblich nach Vater, der hatte eine Abkürzung eingeschlagen, schweigsam einen Fussweg betreten, hatte nicht gemerkt, dass Ottokar gegen eine verkehrsreiche Strasse raste, Trams und Autos vorbeiflitzten. Ottokar sah mit zunehmender Deutlichkeit, dass er in wenigen Augenblicken krachend den Verkehrsstrom unterbrechen würde (einbiegen, sich eingliedern war unmöglich bei der Geschwindigkeit, den Leiterwagen würde es überschlagen in der Kurve). Ottokar griff an die Hinterräder, spritzte Hautfetzen an die scheuernden Speichen und Fingerblut, steuerte auf den Gehsteig zu. Der Wagen schmetterte gegen eine Verkehrsstange, der Kleinkinderkörper auf den Asphalt; die Gefahr indessen war gebannt, wenige Meter vor der Einbiegung unterbrochen die drohende Fahrt. Der Vater stand ärgerlich unten, sagte, wo bleibst du so lange nur, schalt wegen der zerschlissenen Hose.
Des kleinen Ottokars Sträflinge aber erschienen frühmorgens Sensen wetzend auf Herrn Peters Wiesen: weckten Grashalme niederratschend späte Schläfer, fällten Mattenstücke in der zunehmenden Sonnensenge, scheuchten Schmetterlinge auf und Heuschrecken, schlugen Grillen zur Flucht, tranken kühlenden Most unter wehendem Laub und verschwanden aus der brodelnden Sommerglut in ihrem beschatteten Kantonsgefängnis, weite Graswüsten hinterlassend auf den Parzellen Herrn Peters, dem eine Zementfabrik gehörte, eine ausgedehnte Gärtnerei überdies, die ewige Frühmorgenstimmung ausbreitete mit ihren gläsernen Treibhäusern, ein umfangreicher Sportplatz sodann, worauf Glieder eines städtischen Turnvereins geduldet wurden an bestimmten Wochenabenden, im übrigen jedoch Herr Peter persönlich Stabhochsprung übte. Wenn Dieti, Herrn Peters Sohn, mit spitzem Stab heraustrat in die Dämmerung, bog Herr Peter selbst bald in schwarzem Trikot aus dem Gartentor, unternahm Laufen an Ort mit anschließendem Blitzstart und Spurt über kurze Distanz als vorbereitende Maßnahme, ergriff den Stab vor den ehrfürchtigen Zuschauern: Beamten und Arbeitern aus dem Quartier, setzte mehrmals zum Sprung an, bevor er den zierlichen Körper endgültig hinaufschwang in die laue Abendluft, riss, wie immer, die Latte in die sandige Tiefe, entschwand der dankbar applaudierenden Menge mit federndem Schritt und stolz erhobenen Hauptes. Ottokar hatte die unvermögenden Schritte stets als peinlich empfunden, Hohngelächter befürchtet - das hätte sich schlimm ausgewirkt angesichts Herrn Peters göttlicher Stellung im Quartier! Doch die Leute fanden lobende und bewundernde Worte, die Sprünge trotz der sirrend stürzenden Latte beachtlich für sein Alter.
Bezeichnend war Herrn Peters Jagdhund sodann: Flippimänni, ein krummbeiniger Dackel mit spitzbübischem Aussehen, der hin und wieder in Ottokars Garten sich verirrte, an einem Meerschweinchen sich vergriff, hauptsächlich aber Herrn Peters Weidenstauden am Bachufer überwachte, einen Frevler aufspürte eines Sonntagmorgens, einen Insassen des städtischen Altersheimes, den Dieti, Herrn Peters Sohn, aus dem Quartier verjagte, ihm weitere Aufenthalte in der Gegend verunmöglichte: Kleinkinderschüler auf ihn hetzte, die im Chor Weidenstehler Weidenstehler brüllten. Herr Peter jagte auch Ratten, die am Bachufer nisteten, verstand sich aber schlecht aufs Schiessen: oft entwischten die Tiere unversehrt oder mit Streifschüssen im Geäst, selten nur klatschten sie getroffen ins Wasser und hüllten sich in dumpfe Wolken. Später verschwanden die mähenden Sträflinge von den Wiesen, sie übten sich im Korbflechten, und Ottokars frühe Zukunftspläne zerschlugen sich angesichts neuer, verwirrender Ereignisse.
II
Die Flucht auf den Münsterturm hatte Ottokars Existenz am Humanistischen Gymnasium bedroht: der Lateinlehrer hatte Manneszucht bemängelt, was Ottokar kalt ließ, da er noch ein Binggis war in der zweiten Gymnasialklasse und kein Mann, gar keiner sein wollte, noch nicht; Ausschluss aus der Schule ließ sich immerhin vermeiden, wäre auch peinlich gewesen: der Jugendpsychiater hatte ein Wort mitgeredet, hatte Ottokar zugezwinkert in jenem farbigen Sprechzimmer mit den Kinderzeichnungen, überhaupt sehr vertraulich getan: das lässt sich schon einrenken. Die Strafklasse nahm Ottokar gern in Kauf, auch die schlechte Note im Latein, nur den Vater bemitleidete er, der fand es beschämend, und die Mutter, die weinte, grundlos, denn sechs Jahre später bestand Ottokar eine glänzende Matura: rechtfertigte, desavouierte. Nachträglich erschien Ottokar die Flucht ohnehin begründet, durchaus notwendig, vernünftig auch, der Münsterturm der naheliegendste Ausweg aus dem Dilemma: thronte der doch gerade neben dem Schulgebäude; Ottokar trieb es einfach hinauf; er schaffte damit Demütigungen, lästige Erklärungen aus dem Weg: er hatte nichts gelernt, keine Verben, keine Deklinationen repetiert, geschweige denn Konjugationen, hatte in der Zehn-Uhr-Pause erst erfahren vom drohenden Unheil; der Lateinlehrer Fides musste die Schriftliche schon vor vier Tagen angekündigt haben. Ottokar sah den roten Sandstein glimmen in der Morgensonne, lauerte auf die passende Gelegenheit: eine Unaufmerksamkeit des beaufsichtigenden Lehrers, der hatte auch nur zwei Augen; im günstigen Augenblick fixierten sie einen erhitzten Bubenknäuel. Da hieß es einschreiten: energisch, autoritär, die alten Griechen und Römer hatten auch gekämpft, liessen aber Manneszucht walten, achteten edle Beweggründe, jene Rauferei entbehrte humanistischer Grundsätze, nahm pöbelhafte Formen an: entehrte den würdigen Schulhof. Ottokar wusste das zu nutzen, entwich feixend durch das Tor, stieg in den mächtigen Turm ein, erkletterte den muffigen Schacht auf knarrenden Holztreppen, die befreiende Höhe auf Sandsteinstufen: ausgetretenen, verwitterten, war Herr über die Situation jetzt, konnte dem Polizeiwachtmeister, der dort untern untätig herumstand, ungesehen auf den Helm spucken beispielsweise, sogar pinkeln, wenn er wollte, sah auf dem entfernten Marktplatz Hausfrauen Kohlköpfe aussuchen, die grünen Schürzen der Marktfrauen blinkten in der Sonne, schweifte über Hinterhöfe und Hausdachspitzen, beobachtete Sekretärinnen, die klatschten statt schrieben, Süssigkeiten verzehrten zwischen den Diktaten. Er stand mit dem lieben Gott auf du und du, lenkte sein allmächtiges Auge steil hinunter, zum Fenster seines Klassenzimmers: dort sah er den Lateinlehrer Fides zwischen den Bänken amten, humanistische Blicke um sich werfen, bemerkte einen Schüler, sein Vordermann sonst, unter die Bank schielen, wo das Lateinbuch offen dalag: Fides konnte es nicht entgangen sein, sonst war er dumm; er unternahm aber nichts, der war eben Primus, sah erneut unter die Bank: ungestraft! Fides hatte einen gnädigen Tag offenbar, war freundlich gesinnt, trotz der Schriftlichen.
III
Nach bestandener Matur schien Ottokar die Welt zu Füssen zu liegen: der Weg zum Erfolg ist jetzt geebnet, hatte der Vater gesagt. Noch stand die Rekrutenschule bevor, viele Wochen Ertüchtigungsübungen im Kantonnement, auf dem Kasernenhof und im Gelände, im Wald und auf der Wiese - das formt dich zu einem richtigen Mann, hatte der Vater gesagt, zu einem richtigen Mann! Ottokar war wild entschlossen, hörte gut auf seinen Korporal und seine Offiziere - er hörte sie vom Feind sprechen (nein, brüllen!), ständig vom Feind; obwohl Ottokar alle Menschen liebte wie sich selbst. Doch das war jetzt vorbei, da war er noch ein Kind gewesen; jetzt wurde aus ihm ein Mann, ein richtiger Mann.
Der Oberleutnant stand vor ihm, er hatte Züge von seinem Vater, nur war er forscher, vitaler; auch viel jünger, ein dynamischer junger Mann, das konnte man wohl behaupten. Der Oberleutnant schrie ihn an, ihn, dem Sanftmut oberstes Gesetz war; ihn, dessen wackere Meerschweinchen in seinem Garten geweidet hatten. Eines hatte er "Schneewittchen" getauft. An einem kühlen Frühlingsmorgen hatte er sein weißes Fell gefunden, auf einem Kiesweg des Gartens, mit einer dünnen Blutspur am Kopf. Ein Marder hatte es sauber ausgehöhlt. Diese Raubtiere waren oft des Nachts im Garten zu Besuch. Immer wenn Ottokar ein gellendes Pfeifen vernahm, das die nächtliche Stille durchschnitt, in sein Schlafzimmer drang, wusste er: am Morgen würde wieder eines seiner Lieblinge fehlen.
"Rekrut Ottokar, wie haben Sie Ihren Helm angezogen?! Ihr Helm sitzt ja verkehrt auf Ihrem Kopf! Das gibt es doch nicht! Geschirren Sie sich anständig an! Aber ein bisschen schnell!! Zehnmal Liegestütz, hopp, los, eins-zwei... und jetzt kriechen, hopp, los, tiefer in den Dreck, kriechen, kriechen, schneller, schneller! Nicht träumen, los, kriechen...!"
Ottokar kroch, kroch, kroch. Als er sich endlich erhoben hatte, atemlos, gedemütigt, hörte er den Oberleutnant rufen:
"Los, nochmal, kriechen! Wart, ich will Ihnen schon Beine machen .... hopp, los, Sie Arsch..."
Ottokar war jetzt ganz ruhig, so ruhig wie damals, als er auf den Münsterturm gestiegen war. Er sah dem schreienden Oberleutnant ins Gesicht, er sah ein Monstrum mit Helm, dann sagte er ganz ruhig, geradezu sanft:
"Sie sind mein Feind."
Der friedfertige Ottokar zielte gut mit seinem Sturmgewehr.
*
"Das hätten Sie doch viel einfacher haben können", meinte später sein Verteidiger vor der Gerichtsverhandlung, "wenn Sie den Militärdienst verweigert hätten, hätte man Sie nur ein paar Monate eingesperrt und Sie müssten nicht jahrelang im Zuchthaus verbringen."
Doch Ottokar beharrte darauf; der begrabene Oberleutnant war sein Feind gewesen, da war nichts zu machen. Und als das Gerichtsurteil ausgesprochen war: Lebenslänglich, da verklärte sich Ottokars Gesicht. Mit einem Lächeln, das tiefste Befriedigung auszudrücken schien, verließ er den Gerichtssaal.
_________________________________________________________________________
Ein Schweizer am Meer
Von Felix Feigenwinter
"Ich bin ein verunsicherter Schweizer. Meine Verunsicherung hat persönliche, keine politischen Gründe", bemerkt ein in einem Eisenbahnzug nach Holland Reisender zu einer Dame, die sich in Köln auf einem reservierten Platz neben ihm niedergelassen hat und ihn in ein Gespräch verwickelt.
"Sind Sie vielleicht geschieden?" forscht die Dame.
"Nein, ich bin Witwer" antwortet der Mann; "aber ich leide unter Atemnot, sobald ich die Höhe von zirka 1800 Metern über Meer übersteige. Wie kann einer ein senkrechter Eidgenosse sein, wenn er sich schon nach zwei, drei Tagen Aufenthalts in den Bergen von einem Sauerstoffkollaps bedroht fühlt? Ist einer ein hundertprozentiger Schweizer, wenn es ihm elend und schwindlig wird, er wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Luft zu schnappen beginnt, sobald er die hehre Alpenwelt betritt? Ein solcher Mensch sitzt neben Ihnen; ich bin ein Mann, der das Leben im Gebirge schlecht verträgt! Zum Glück wohne ich in der Tiefe, unten in Basel, am Dreiländereck am Rheinknie."
"Und jetzt reisen Sie in die Sommerfrische?" vermutet die Frau.
"Ich fahre zum Meer hinunter, zur Nordsee, wo ich meine Ferien verbringen möchte."
"Können Sie wenigstens jodeln?" fragt nun die Reisebekanntschaft und lacht; Humor scheint ihr nicht fremd zu sein.
"Nein" bekennt der Eidgenosse, "ich blase auch kein Alphorn."
Abends sieht er die Frau wieder, und er wundert sich, dass sie sich ebenfalls an diesem Ferienort aufhält, wo er in einem Dreisternhotel logiert, denn vor dem Umsteigen im Amsterdamer Bahnhof hatte er sich von ihr verabschiedet in der Meinung, er würde ihr nie mehr begegnen. Nun vereinbaren sie in ihrer Ueberraschung, gemeinsam zu essen. Sie setzen sich draussen vor ein kleines Spezialitätenrestaurant, bestellen Fisch und Bier. Die Deutsche erklärt, sie spüre eine furchtbare Deutschenfeindlichkeit vieler Holländer, was Jahrzehnte nach dem Kriegsende doch kaum mehr verständlich sei. Später stösst der inzwischen vielleicht schon ein wenig betrunkene Schweizer sein Bierglas derart heftig an jenes der Deutschen, dass das Glas der Dame in Brüche geht.
Am nächsten Tag - es ist nun später Morgen, das üppige Frühstück im Dreisternhotel hat er massvoll genossen - sitzt der Schweizer, der auch Schweizer heisst, Köbi Schweizer, keine fünfzig Meter über Meer in einem Buchenwäldchen allein auf einer grünen Bank und staunt auf ein offenbar stilles braunes Gewässer, das sich bei günstigem Lichteinfall in einen glasklaren Spiegel verwandelt, wo sich die Baumkronen unter dem hellen Himmelblau erstaunlich deutlich spiegeln. Dass das stille, dunkle, von Zeit zu Zeit heiter aufleuchtende Gewässer nicht tot ist, wie es zuerst den Anschein erweckte, beweisen dem Feriengast ein Schwarm kleiner, dunkler Fische - sie erinnern ihn an Kaulquappen, so winzig sind sie - , die knapp unter der Wasseroberfläche herumtanzen. Die Spiele des Lichts und der von Zeit zu Zeit durchs Buchenwäldchen huschende Wind sorgen für die Belebung des nicht fliessenden Kanals.
Herr Schweizer erhebt sich von der grünen Bank, schwingt sich aufs gemietete Fahrrad, das er auf den sandigen Waldboden gestellt hatte, und fährt aus dem Buchenwäldchen, in dem auch einige wenige knorrige Eichen stehen. Ein Radfahrerweg führt entlang einer Autostrasse durch die von Nadelholz gesäumten Dünen hinunter zum Meer.
Den ganzen Nachmittag verbringt der Mann nun am Strand, wo er in einem Strandkorb döst, ein wenig dem Meer entlang spaziert, sich später auf ein mitgenommenes Badetuch legt, die weissen, meergrauen und sandbraunen kleinen und grossen Möven beobachtet, die durch den Sand stelzen und wie Hühner nach Futter picken, und schliesslich in einem der Strandpavillons mit Zwiebeln und Gurkenscheiben garnierte Matjiesheringe isst. Gegen Abend wandert er barfuss dem Meer entlang, den unaufhörlichen Rhythmus des Wellenrauschens im Ohr; den Wind, der die brühende Sonnenhitze zerpflügt, empfindet Herr Schweizer als zärtliche Liebkosung auf seiner Haut. Irgendwann kehrt er um, um seine Sachen im Strandkorb und das in der Nähe des Meers abgestellte Mietvelo sicherzustellen; staunend erlebt er, wie der glitzernde und funkelnde Schleier, den das Sonnenlicht übers Meer geworfen hatte, zu einem schmalen, leuchtenden Teppich zusammengezogen wird, der sich bald zu einer flimmernden Sonnentreppe verwandelt, die schliesslich ganz verschwindet. Die Sonne errötet zusehends, wird zu einem orangenen Lampion; dann beginnt sie, am Horizont zu versinken. Der Himmel verfärbt sich rosa und lila, dunkelt ein, die am Strand sich tummelnden Menschen, Hunde und Pferde erscheinen als scharfe, dunkle Silhouetten vor dem schon matter leuchtenden, aber immer noch hellen Meer - Schattenrisse, die ein uraltes Naturschauspiel feiern. Am Himmel übernimmt der vorher fast unscheinbare, weil blasse Mond die Ablösung: er beginnt sich zu verfärben, erregt mit warmem Gelb neue Aufmerksamkeit. Die Flut hat die Ebbe abgelöst.
Am darauffolgenden Tag schreibt Herr Schweizer nach dem Frühstück im Hotel seinen zu Hause gebliebenen Arbeitskolleginnen und -kollegen. Er notiert auf die Rückseite einer Ansichtskarte, auf der ein etwas kitschig aussehender Sonnenuntergang am Meer abgebildet ist: "Der Aufenthalt am Meer ist für mich ein wahres Antidepressivum. Ich hoffe, es reicht für mich aus, das Büroleben in der Schweiz für ein weiteres Jahr durchzustehen."
Anschliessend unternimmt er eine lange Velofahrt in eine entfernt liegende Stadt, wo er ein Museum besucht; erst nach Einbruch der Dunkelheit kehrt er in seinen Ferienort zum Hotel zurück. Frohen Sinnes denkt er, über genügend Ferientage zu verfügen, um den Sonnenuntergang am Meer noch mehrere Male zu erleben.
Doch am nächsten Morgen ist der Himmel bedeckt; ein diesiger Nebel hängt über dem Strand, zu dem Herr Schweizer gleich nach dem Frühstück radelt. Es ist kühl geworden. Trotzdem bleibt er am Meer, watet stundenlang durch den Sand, hofft, die Sonne würde sich im Verlauf des Nachmittags doch noch zeigen. Statt dessen hebt ein Sturm an, der, je näher der Abend kommt, heftiger wird und zu einem Orkan anschwillt. Herr Schweizer rettet sich zitternd vor Nässe und Kälte in einen gedeckten Strandpavillon, von wo aus er das Unwetter verfolgt, entsetzt aufs tobende Meer starrt, dessen Sanftheit von vorgestern für alle Zeiten weggepustet scheint. Er bestellt eine Hühnersuppe, um Seele und Körper aufzuwärmen. Als ihm die flachsblonde Serviererin die dampfende Schale auf den Tisch stellt, seufzt er: "Ein Trost bei diesem grausigen Wetter!" Die Holländerin lacht, aber hinter seinem Rücken antwortet die kräftige Stimme einer anderen Frau: "Sie befinden sich hier nicht am lieblichen Rheinknie, Herr Schweizer. Sie erleben den wahren Charakter unserer Nordsee!" Der Schweizer denkt: das Basler Rheinknie ist nicht lieblich; es ist ruhig, kultiviert, ordentlich strukturiert, das wohl; der Strom ist gezähmt. Er wendet sich um und sieht am Tisch hinter sich eine Frau sitzen, die - halluziniert er? - ein zerbrochenes Bierglas in der rechten Hand hält und ihn ebenso vorwurfsvoll wie spöttisch zu mustern scheint. Er weicht der Herausforderung aus, wendet sich wieder seiner Suppe zu, die er hastig auslöffelt. Hierauf eilt er zur Theke und bittet die Holländerin, ein Taxi zu bestellen, das ihn und sein gemietetes Fahrrad zum Hotel zurückfahren soll.
Tags darauf - der schreckliche Sturm hat sich gelegt, aber am Himmel türmen sich düstere Wolken, und der Wind pfeift vom Meer her warnend übers platte Land - reist der Schweizer früher als geplant in sein geordnetes Binnenland zurück.
_________________________________________________________________________
Evas Ausflüge
Von Felix Feigenwinter
Eva Meier sass auf einem Bänklein des örtlichen Verkehrsvereins und blickte über eine ungemähte wogende Wiese – ein von Hitze und Wind zerpflügtes weites Pflanzenfeld, dessen Grün mit gelben, lila und blutroten Blüten durchsetzt war. Auf den Gräsern, die im Wind tanzten, glänzte der Schein der hohen Sonne; der See im Hintergrund war ein glitzernder hellblauer Spiegel, an dessen Rändern Nadelbäume violette Schatten warfen. Ringsum strotzten in milden Dunst gehüllte Bergriesen; auf den höchsten Gipfeln schimmerte es schneeweiss.
Das Bild war Eva vertraut. Jeden Sommer, in den Juliwochen, aber auch während der winterlichen Hauptsaison, tritt sie in der eleganten Bar des grossen Hotels auf, das sich wie eine feudale Festung über dem Feriendorf erhebt. Dort greift sie in die Tasten (es ist für sie Ehrensache, mit nie erlahmender Begeisterung sorgfältig, aber auch brillant und immerzu kreativ zu spielen, nicht einfach zu klimpern wie so viele ihrer routinierten und resignierten Berufskollegen, die als Barpianisten keinen künstlerischen Ehrgeiz mehr zu entwickeln schienen), und manchmal, wenn ihr das Publikum dafür empfänglich scheint, begleitet sie ihre Klaviermusik mit leidenschaftlichem Gesang. Eva Meier tritt als Eva Schmetterling auf, ein Künstlername, der ihr im Traum zugefallen war, als sie noch nicht als Barpianistin durchs Land zog, sondern als Studentin Ambitionen als Konzertpianistin hatte.
Während Eva nun ihre Nachmittagspause da draussen auf einem Bänklein verbrachte und das ihr vertraute Bild der Berglandschaft in sich einsog, begann ihre musikschwangere Seele zu jauchzen und hinauszuschwirren in die leichte, reine Alpenluft; rhythmisch und melodisch flatterte sie über die Wiese von Blüte zu Blüte, und es erstaunte sie, dass sie weit und breit der einzige Sommervogel war.
Als sie dann am Abend den Hotelraum betrat, wo der Flügel stand, ein fast protzig grosses Instrument mit glänzender Oberfläche, und wo sich die Bar und die Clubsessel befanden, von wo aus die Besucher Evas Improvisationen entspannt folgen konnten, war erst ein einziger Gast anwesend. Dieser Frühankömmling, ein älterer Herr, sass an der Bar vor einer Spirituose; ein eigentlich unscheinbarer, graumelierter, schmaler Mann, der nun mit feingliederigen Fingern das Glas ergriff, um das Getränk vorsichtig zu schwenken; dabei musterte er Eva durch beschlagene Brillengläser und erwiderte ihren Gruss mit einem undeutlichen Kopfnicken. Eva setzte sich an den glänzenden Flügel und begann mit ihrem Abendprogramm. Allmählich füllte sich der Raum mit verschiedenen Leuten, Hotelgästen aus aller Welt, aber auch einheimischen Dorfbewohnern und einigen Menschen aus den umliegenden Ferienwohnungen. Es war Freitag, und der Andrang war dichter als an gewöhnlichen Abenden (Eva bevorzugte die stilleren, beschaulicheren Stunden); im Hotel tagte ein akademischer Kongress, und später belagerte auch eine Gruppe von übermütigen jungen Leuten Evas Piano, Teilnehmer eines Weiterbildungskurses, der im Ferienort stattfand. Die jungen Gäste äusserten Musikwünsche, verlangten Stücke, die nicht alle zu Evas Repertoire gehörten, und ein betagter Rentner, ein reicher Witwer, wie Eva vermutete, überhäufte sie mit Komplimenten, spendete ihr teure Getränke und konfrontierte sie gar mit einem vielleicht ernst gemeinten Heiratsantrag, den sie charmant zurückwies. Kurz darauf erlitt dieser Greis einen Schlaganfall und musste von einer Ambulanz wegtransportiert werden. (Am Abend danach erfuhr Eva vom Hotelarzt, dass der Kavalier noch in der gleichen Nacht verstorben sei.)
Die von den Gästen verursachten Geräusche, das Stimmengewirr, viel Gelächter, auch das Klirren und Klappern von Gläsern, Essgeschirr und Besteck, übertönten bisweilen Evas Musik und Gesang. In all dem Trubel verlor sie den ersten Gast des Abends, den schmalen, bebrillten älteren Herrn mit seinem Spirituosenglas, keineswegs aus ihrem Blick. Zwar hätte sie nicht beurteilen können, welche und wie viele Getränke dieser Einzelgänger im Verlauf des langen Abends bestellt und geschlürft haben mochte, doch je länger sie ihn von ihrem Klaviersessel aus beobachtete, desto sicherer war sie, dass sie ihm vor vielen Jahren als Studentin schon einmal begegnet war, ihn bewundert, sogar verehrt hatte.
Eva erinnerte sich an einen eifrigen jungen Mann mit Künstlermähne, mit dem sie damals das Kunstmuseum ihrer Heimatstadt durchwandert hatte, wo er sie mit gescheiten kunsthistorischen Erklärungen beeindruckte. In jener Zeit arbeitete er an einem Text, den sie für ihn ins Reine tippte, aus Idealismus, aus Begeisterung, aus Respekt vor dem jungen Mann mit der Künstlermähne, und aus Ergriffenheit über die Bilder einer hochbegabten Malerin, einer ihr bisher unbekannten einheimischen Künstlerin, deren Werke Peter Schällimatt, so hiess der junge Kunsthistoriker, in einer Galerie entdeckt hatte und nun mit scharfsinnigen Ueberlegungen analysierte. Eva hatte sich für die Malerin interessiert, wollte sie persönlich kennenlernen, was sie Schällimatt anvertraute, sie bat ihn um Vermittlung; der war der Künstlerin an einer Vernissage persönlich begegnet, hatte sie später in ihrem Atelier besucht, wie er Eva erzählte, um möglichst viele ihrer Gemälde für seinen Text zu inspizieren. Schällimatt reagierte auf Evas Anliegen unerwartet arrogant und autoritär: die Person und das Leben eines Künstlers seien unwichtig, belehrte er sie schroff, die Biografie lenke vom Wesentlichen ab – von der Kunst, um die es letztlich gehe; er sehe nicht ein, warum sie diese Malerin persönlich kennenlernen wolle, das sei unnötig. Eva war zutiefst enttäuscht und verletzt; ihre Beziehung zu Schällimatt war unrettbar zerbrochen. Schällimatt schien dies nicht zu stören; er suchte keine Verständigung, kümmerte sich nicht mehr um Eva, verfolgte unbeeinträchtigt seine ehrgeizigen Ziele.
Der ältliche Herr, der einen Abend lang an der Bar sass und Evas Klavierspiel und Gesang zu lauschen schien, war Peter Schällimatt, davon war Eva mittlerweile überzeugt, obwohl das einst Charakteristische an seiner äusseren Erscheinung, die verwegene Künstlermähne, weggeschnitten war; der Mann sah nun banaler aus, fand sie; sein Kopf schien geschrumpft; aber die Gesichtszüge waren ihr vertraut.
Während einer Pause begab sich Eva zur Bar und sprach den zwischen übermütig plaudernden jüngeren Gästen in sich versunken dasitzenden Einzelgänger an. „Sind Sie nicht Herr Schällimatt?“, fragte sie vorsichtig. – „Der bin ich“, bestätigte der Gast. – „Dann kennen wir uns“, erwiderte Eva, „vor vielen Jahren habe ich Dir einen Text ins Reine getippt, eine Arbeit über die Bilder einer jungen, vielversprechenden Malerin.“
„Ach, wie spassig!“, bemerkte Schällimatt, der sich nun aufreckte, „das ist lange her! Eva Meier?!“ – „Ja, immer noch. Hier trete ich als Eva Schmetterling auf, mein Pseudonym.“
Schällimatt nickte. Eva erinnerte ihn daran, wie er sich damals geweigert hatte, sie mit der Malerin in Kontakt zu bringen – weil angeblich die Person und das Leben der Künstlerin nicht wichtig seien, von der Kunst nur ablenkten. Schällimatt stutzte und meinte trocken: „Diese Malerin ist übrigens gestorben. Sie hat sich das Leben genommen. Ich habe es erst kürzlich erfahren, weil man mich anfragte, ob ich an einer Gedenkausstellung reden könne. Ich musste absagen.“ – „Ist das alles, was Dir dazu einfällt?“, fragte Eva, bevor sie sich zurückzog, um ihre Arbeit am Flügel fortzusetzen – aufgewühlt, traurig, empört.
Am nächsten Tag entdeckte sie im Foyer des Hotels ein Plakat. Mit wachsender Verblüffung las sie:
Votrag von Professor Peter Schällimatt.
Nationalsozialistisches Kunstverständnis hinsichtlich der Biografie von Adolf Hitler und dessen Scheitern als Kunstmaler.
Professor Schällimatt signiert sein soeben erschienenes neues Buch zu diesem spektakulären Thema.
Eva überlegte: Wie war Schällimatts Interesse für das Leben von Adolf Hitler zu erklären, für dessen Scheitern als Kunstmaler – angesichts seiner Ignoranz gegenüber dem Schicksal einer Malerin, deren Bilder er einst analysierte, unabhängig von der Künstlerin und deren Biografie, die er missachtete? War es ganz banal die Aussicht auf hohe Auflagezahlen für ein Buch über eine weltbekannte historische Schreckensgestalt? Dagegen bot die tragische Nischenexistenz einer Malerin, deren Bilder ihm willkommenes Material für eine kleine kunstwissenschaftliche Textübung lieferten, keine Garantie für eine erfolgreiche Vermarktung und Förderung seiner Reputation als etablierter Publizist.
Gegen Abend jenes Tages setzte sich Eva wieder auf die Bank des örtlichen Verkehrsvereins mit Blick auf die Sommerwiese und den See im Hintergrund. Während sie sinnierte, näherten sich ihr auf dem schmalen Spazierweg, der an der Bank vorbeiführte, Peter Schällimatt und eine Dame, wohl die Gattin des Professors, die diesem vielleicht nachgereist war, um dessen Vortrag über das nationalsozialistische Kunstverständnis beizuwohnen. Noch bevor das Paar die Bank erreichte, startete Eva zu einem Ausflug über die Wiese
WEITERE ERZÄHLUNGEN VON FELIX FEIGENWINTER:
ENDE EINER LAUFBAHN / DIE STIMME / EIN TRÄUMER / EIN UNERKLAERLICHER FALL / SCHWELLE ZUM PARADIES / DAS RUFEN DER MUTTER / DAS LACHEN IN DER NACHT / BESUCH BEIM GEIER
auf der Website Felixfeigenwinter's Blog (wordpress): http://felixfeigenwinter.wordpress.com
STÄUBLI
auf der Website der journalist felix feigenwinter (wordpress): Der Journalist