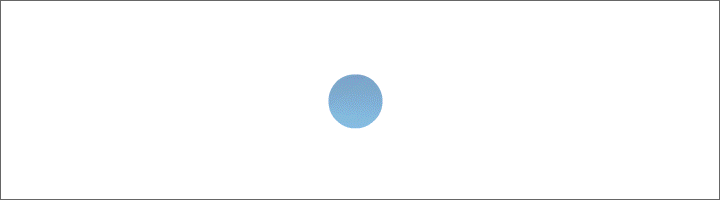Ein schwieriges Leben
Von Felix Feigenwinter
"Wer Adelheid Duvanels Leben kennt, ihren sechzigjährigen Weg vom Waisenhaus in den Selbstmord, weiss, was das heisst." So schrieb Andrea Köhler im Feuilleton der "Neuen Zürcher Zeitung" vom 13. Mai 1997 im Zusammenhang mit der zehn Monaten nach ihrem Tod im Kunstmuseum Solothurn anlässlich der Literaturtage veranstalteten Gedenkausstellung, wo auch literarische und zeichnerische Frühwerke der "Chronistin der Unangepassten" erstmals öffentlich gezeigt wurden.
In Wirklichkeit ist die unter Literaturkennern Jahrzehnte lang als "Geheimtip" gehandelte Schriftstellerin, die vor der Eheschliessung mit dem Maler Joseph E. Duvanel ebenso intensiv zeichnete und malte wie sie schrieb, keineswegs in einem Waisenhaus aufgewachsen. Sondern im Schoss einer gutbürgerlichen Familie, als (eheliche) Tochter des katholischen Lehrersohns Georg Feigenwinter aus Arlesheim, der als kirchen- und staatstreuer Jurist sowie Inhaber diverser Ehrenämter in konservativ-bürgerlichen Gesellschaftskreisen beträchtliches Ansehen genoss, und der Stadtbaslerin Elisabeth Lichtenhahn, deren protestantische Sippe im Kreuzgang des Basler Münsters mit einem historischen Grabmal vertreten ist.
Die auch unter Literatursachverständigen offenbar hartnäckig grassierende Vorstellung, Adelheid Duvanel sei tatsächlich im Waisenhaus aufgewachsen, mag von Geschichten der Schriftstellerin genährt worden sein, die sich zum Teil wie biografische Texte lesen. Schon als Schulkind hat sich Adelheid mit Waisenkindern identifiziert. Eine ihrer ersten Erzählungen ("Seppli") hatte sie mit Bleistift 1946, also als Zehnjährige, auf 36 Seiten zu Papier gebracht (der Kinderroman wurde an der Solothurner Ausstellung erstmals öffentlich gezeigt). Die Hauptfigur, das Waisenkind Seppli, stellt das Mädchen Adelheid einleitend in Wort und Bild vor. Unter dem Farbstiftporträt des imaginierten Knaben Seppli schrieb die kindliche Autorin mit sorgfältiger Schülerschrift:
"Seppli Luginbühl, von dem diese kurze Geschichte erzählt. Als er sechs Jahre alt war, verlor er seinen Vater. Mit acht Jahren ward er Vollwaise."
Manche der späteren Texte wirken autobiografisch, weil sie in Ich-Form geschrieben sind. Im Text "Enttäuschung", der im Lesebuch "Über Erwarten" (Jubiläumsausgabe der Literaturzeitschrift "drehpunkt", 1998 im Lenos Verlag, Basel) neu veröffentlicht wurde, berichtet die fiktive Ich-Erzählerin:
"(...) Sie war meine Patin; ich war nach ihr getauft worden und verbrachte, nachdem man mich von meiner liederlichen Mutter weggenommen hatte, deren uneheliches Kind ich war, ein halbes Jahr bei ihr; nachdem sie aber schwer erkrankt war, wurde ich in ein erstes, zweites und drittes Heim gesteckt. In jedem fühlte ich mich wie eines von 50 oder 100 Schaumkörnchen, die von den Leiterinnen umher- oder weggeblasen werden konnten. Dass es Wellen gab und Tiefe, ahnte ich, und dass es Schiffe gab, die stampfend und Aufruhr bringend über einen hinwegfahren konnten, wusste ich, seit mein Onkel Raymond nach Tante Agnes' Tod mich aus dem Heim holte; ich war nun dreizehn Jahre alt. (...)"
Ich kann mich übrigens erinnern, wie sich ein Berufskollege von mir, Redaktor einer Basler Lokalzeitung, darüber ärgerte, dass meine Schwester Adelheid derartige "Unwahrheiten" über ihr Leben verbreite, wie er damals meinte, nachdem eine dieser Geschichten in den Sechzigerjahren zum erstenmal erschienen war. Meine Schwester sei doch in einem ordentlichen Elternhaus aufgewachsen, entrüstete sich dieser Wahrheitshüter (der, zum Trost sei's erwähnt, fürs Ressort "Literatur" nie zuständig war)...
Aber auch zeichnerisch hat sich Adelheid, die in der Geborgenheit einer äusserlich intakten Familie aufwuchs, schon früh und immer wieder mit "armen Kindern" auseinandergesetzt, wie sie auch die im Schulalter gezeichnete Flüchtlingskinder nannte, die in den Nachkriegsjahren in der damaligen Wohngemeinde Liestal und im Basler Bahnhof auftauchten. Das Schicksal solcher kriegsgeschädigter Kinder hatte die kleine Adelheid nachhaltig beschäftigt.
Dass Adelheids aussergewöhnliche Begabung von den Eltern unerkannt und ungefördert geblieben wäre, stimmt mit Sicherheit nicht. Verschiedene Dokumente (neben Briefen und Fotos auch sorgfältig gesammelte und vom Vater säuberlich mit Datum etc. versehene Kinderzeichnungen) aus dem Nachlass der wenige Monate nach dem Suizid der Tochter verstorbenen Eltern bezeugen, dass die Eltern das kreative Tun des Kindes auch zu würdigen wussten. Die Frage bleibt natürlich trotzdem, wie weit sich das sensible, hochbegabte Mädchen in der konservativ-strengen katholischen Vaterwelt, deren Rigorosität durch den liberaleren, städtisch-protestantischen Geist der in ihrem Lebensstil allerdings auch konventionellen, sehr disziplinierten Mutter nur teilweise aufgelockert wurde, wirklich zu entfalten vermochte. Die in der Familie Feigenwinter-Lichtenhahn durch die Eltern zelebrierten Lebenskonventionen, geprägt vor allem durch die katholisch-ideologischen Moralvorstellungen der patriarchal-ländlichen Herkunftsfamilie des Vaters (der Einfluss der protestantischen, urbanen Herkunftsfamilie der Mutter war höchstens subversiv spürbar), war für ein kreatives Kind wie Adelheid auf die Dauer bestimmt kein idealer Nährboden und wurde spätestens beim Eintritt ins Erwachsenenalter zum Fallstrick.
Vor diesem Hintergrund konnte die Bekanntschaft und Heirat mit dem Kunstmaler Joseph E. Duvanel vorerst wie eine Rettung aus dem "Familiengefängnis", als willkommener Ausbruch aus psychischer Erstarrung und gesellschaftlicher Isolation erscheinen. Frühe Selbstmordversuche hatten zu wiederholten Einweisungen in psychiatrische Kliniken mit zum Teil gravierenden und zumindest aus heutiger Sicht fragwürdigen therapeutischen Eingriffen mit langfristigen Internierungen, Elektroschocks und Insulinbehandlungen geführt (damals die üblichen Therapien für Schizophrene). Solche Rosskuren erscheinen heute in einem umso beklemmenderen Licht, als Adelheids langjähriger privater Psychiater in einem Gespräch mit Verwandten nach der lange geplanten, oft versuchten, endlich "geglückten" Selbsttötung über vier Jahrzehnte nach ihren ersten Erfahrungen mit der Psychiatrie die Frage, ob Adelheids Krankheit schulmedizinisch als "Schizophrenie" diagnostiziert werden müsse, entschieden verneinte.) - Zweifellos bedeutete der Schritt aus dem materiell abgesicherten, jedoch engen und starren Normen unterworfenen, spontane Lebensäusserungen abwehrende Dasein im bürgerlichen Haushalt der Eltern ins "freie, wilde Kunstleben" eine Herausforderung. Neue Erfahrungen, auch neue Bekanntnschaften ausserhalb der bis anhin eng gesteckten Grenzen weckten neue Lebensgeister.
Doch das abenteuerliche Leben der Bohème war patriarchal geprägt. Insofern änderte sich für Adelheid Duvanel nach der Eheschliessung wenig; die Unterdrückung wurde sogar massiver und bedrohlicher. Anstelle des das Familienleben selbstgerecht, aber gewissenhaft verwaltenden streng katholischen Pflichtmenschen Georg Feigenwinter, der persönlich bescheiden blieb, trat nun der leidenschaftliche, selbstherrliche, despotische Anarchist "Joe" E. Duvanel, ein nachtaktiver, wilder Traumtänzer.
Im Kreis der damaligen Basler Bohème war "Joe" eine schillernde Figur, der sich jeder gängigen Klassifizierung zu entziehen schien. Obwohl er im basellandschaftlichen Pratteln aufgewachsen war (übrigens in jenem Industriedorf, wo Adelheid ihre ersten Kinderjahre verbrachte) und seine schulische und malerische Ausbildung zum Teil in Basel erhielt, blieb er im kulturellen Basel, auch im Kreise seiner Malerkollegen, ein farbiger Aussenseiter, ein "Exot". Dass er sich eher mit der französischen und englischen Kultur identifizierte als mit der deutschen beziehungsweise deutschschweizerischen, hatte wohl mit seiner Herkunft als Sohn eines französischsprechenden Vaters und einer englischen Mutter indischer Abstammung zu tun. Ausserdem entwickelte er eine besondere Zuneigung zur ungarischen Kultur - dies auch dank der intensiven Freundschaft zum ungarischen Maler Ference Janossy, der in den Sechzigerjahren als Asylant in Basel lebte (vorübergehend auch in Duvanels Wohnung; später reiste Joe mehrmals nach Ungarn, um den in seine Heimat zurückgekehrten Freund zu besuchen).
Frauen waren für Bohèmien Joe Duvanel und sein Umfeld nicht als gleichberechtigte Partnerinnen oder Künstlerkolleginnen vorgesehen, sondern als Musen; sie hatten das ungebundene Künstlerleben ihrer Ehemänner oder Freunde bewundernd und wohltätig zu begleiten und notfalls durch Berufstätigkeit in einem "bürgerlichen" Beruf zu ermöglichen. Diese Erfahrung blieb auch Adelheid Duvanel nicht erspart. Umso mehr erstaunt, dass die sensible Poetin neben ihren Aufgaben als Mutter, Pflegemutter und Hausfrau, neben ihren Teilzeitjobs in Büros und als freie Journalistin sowie bei all ihren Beanspruchungen als Mitgastgeberin für illustre und andere Eingeladene zu wilden Ess- und Saufgelagen "chez et avec Joe" immer wieder die Zeit und Kraft aufbrachte, Geschichten zu schreiben. Das Malen hatte sie aufgegeben und erst wieder damit begonnen in der psychiatrischen Klinik anfangs der Achtzigerjahre, als sie sich von Joe definitiv trennte.
Der letzte Lebensabschnitt von Adelheid Duvanel, ihr Dasein als geschiedene Frau reiferen Alters, hätte unter "normalen Umständen" eine Chance für ein unabhängiges, eigenständiges Künstlerleben bedeuten können. In Wirklichkeit verschlimmerte sich die psychische und soziale Not; das Unglück eskalierte. Nach dem Selbstmord des geschiedenen Manns (im Dezember 1986) wurde Adelheid je länger desto bedrückender mit dessen "Hinterlassenschaft" konfrontiert. Das Schicksal der aidskranken und drogenabhängigen Tochter und von deren Tochter, dem geliebten Enkelkind, beeinflussten in existentieller Weise ihr eigenes Leben und erlaubten der nun immer mehr auch mit öffentlichen Auftritten - Lesungen, Entgegennahmen von Literaturpreisen etc. - beschäftigten Autorin keineswegs die gewünschte freie Entfaltung als Schriftstellerin und Malerin.
Um hier die vielen bedrückenden Einzelheiten der gespenstischen Lebensumstände der jahrelang in räumlich, aber auch finanziell unglaublich engen und demütigenden Verhältnissen lebenden Geschichtenerzählerin nicht aufzählen zu müssen, sei eine typische Episode aus ihrem Sterbejahr stellvertretend erwähnt: Als ich mit Adelheid nach ihrer Lesung an den Solothurner Literaturtagen im Mai 1996 nach Basel zurückfuhr, sagte sie mir: "Wenn ich jetzt nach Hause komme, wartet ein Dealer in der Wohnung, um mir das Honorar abzunehmen, das ich für die Lesung bekommen habe. Drogenschulden!"
Seitdem Adelheid wieder ihre kranke Tochter in die Wohnung aufgenommen hatte, um sie zu betreuen, war auch sie selber zur Geisel krimineller und erpresserischer Elemente aus der Drogenszene geworden. Warum ihr niemand aus der Verwandtschaft geholfen habe, fragten nach ihrem Tod gedankenlos einige Aussenstehende. Um es noch einmal klarzustellen: Die Verwandten (die Geschwister und deren Ehepartner, aber auch die Eltern bis ins hohe Greisenalter) haben zu helfen versucht, immer wieder, alle nach ihren Möglichkeiten, teils bis an den Rand der Selbstgefährdung.
Zukünftige Analysen von Leben und Werk der Schriftstellerin, die an die zwanzig Jahre in der Basler Literaturszene nur von wenigen "Eingeweihten" erkannt wurde, ehe sie als Vierundvierzigjährige einen grösseren Verlag fand, der ihrer Kunst zur angemessenen Beachtung verhalf, mögen an den Tag bringen, wie wenig haltbar die um den Bohème-Kult gerankte literarische Legende ist, will man sie für die eigenen kulturpolitischen Zwecke zur Romantisierung eines Lebensstils vereinnahmen.
Nach dem Zusammenbruch der attraktiven Ära Joe, als das vielgefeierte Fest verrauscht und der Freundeskreis in alle Winde zerstoben war, blieben zwei schwerkranke Frauen zurück.
Felix Feigenwinter
Der obige Text ist eine Zusammenfassung des Vorworts des Bruders der Schriftstellerin Adelheid Duvanel, Felix Feigenwinter, im biografischen Werk "Scheherezadel, eine Basler Autorin wird entdeckt, Reflexionen zu Leben und Schaffen von Adelheid Duvanel" von Gudrun S. Krayfuss (1998 Verlag Isishaus, Basel).
POSTUME ANERKENNUNG DER MALERIN ADELHEID DUVANEL
Leserbrief von Felix Feigenwinter, erschienen am 3. Juni 2016 in der bz / nordwestschweiz, betr. Artikel von Martina Kuoni „Wenn der Alltag zum Ungeheuer wird“ in der „Basellandschaftlichen Zeitung“ vom 21. Mai 2016.
Martina Kuoni sei gedankt für ihr aufmerksames und subtiles Gedenken anlässlich des 80. Geburtstags der in Pratteln und Liestal aufgewachsenen Basler Luchterhand-Autorin Adelheid Duvanel (1936-1996). Ergänzend sei daran erinnert, dass die ebenso aussenseiterische wie bemerkenswerte Schriftstellerin zuerst im Ausland etablierte Anerkennung fand (1984 mit dem Kranichsteiner Literaturpreis), bevor sie in ihrem Heimatland entsprechend geehrt wurde (1987 mit dem Basler Literaturpreis, 1988 mit dem Gesamtwerkspreis der Schweizer Schillerstiftung und 1995 mit dem Gastpreis der Stadt Bern). In seinen Büchern «Die tintenblauen Eidgenossen» (2001) und «Das Kalb vor der Gotthardpost» (2012) reflektierte der Literaturprofessor Peter von Matt postum über die eigenwilligen Geschichten dieser besonderen Repräsentantin der Schweizer Literatur aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Malerin fand Adelheid Duvanel erst nach ihrem Tod öffentliche Beachtung, zuerst 1997 in einer Gedenkausstellung im Kunstmuseum Solothurn im Rahmen der damaligen Literaturtage, später dann 2009 in der Ausstellung «WÄNDE dünn WIE HAUT», einer umfassenden Präsentation des zeichnerischen und malerischen Werks der Künstlerin im «Museum im Lagerhaus» in St. Gallen, wo die Museumsleiterin Dr. Monika Jagfeld das in Basel ignorierte Werk kompetent analysierte.
Felix Feigenwinter, Basel
____________________________________________________________________________________________
„Délai de grâce“
Beglückende Überraschung anfangs März 2018 dank einer Postsendung aus Frankreich: Die Übersetzerin Catherine Fagnot aus Nancy schickt mir das soeben von der belgischen Edition Vies Parallèles, Brüssel, herausgegebene Buch „Délai de grâce“ mit von Frau Fagnot in die französische Sprache übersetzten Texten meiner Schwester Adelheid Duvanel, eine Geschichtensammlung, die 1991 unter dem Titel „Gnadenfrist“ bei Luchterhand, Frankfurt am Main, in der deutschen Originalfassung erschienen ist und nun, 27 Jahre später, im französischen Sprachraum veröffentlicht wird. Grund zur Freude und Dankbarkeit!
Liebe Frau Fagnot,
welch‘ schönes Erlebnis, als ich in meinem Postfach das Paket aus Nancy vorfand und Ihren freundlichen Brief und das neue Buch mit Adelheid Duvanels „Gnadenfrist“-Texten in französischer Sprache in Händen halten durfte! Für mich überraschend, wie schnell dieses Projekt nun verwirklicht werden konnte. Glücklicherweise konnten die Fragen betreffend das Copyright offenbar geklärt werden, was mich natürlich ebenfalls freut.
Für die Zusendung dieser wunderbaren Gabe danke ich Ihnen sehr, ebenso für Ihre nach meiner Einschätzung äusserst kompetente, einfühlsame Übersetzung der einundvierzig Kurzgeschichten meiner Schwester. Auch Cover und Format gefallen mir, die gesamte grafische Gestaltung ist exzellent. Ein gediegenes Buch, ein Gesamtkunstwerk!
Meine Freude über Ihr Geschenk überstrahlt momentan meine Bedrängnis wegen meiner gesundheitlichen Schwierigkeiten (Operation, zermürbende Untersuchungen, endlos scheinende Therapien); auch dafür bin ich Ihnen dankbar.
Mit einem herzlichen Gruss aus Basel
Felix Feigenwinter, 5. März 2018
____________________________________________________________

|