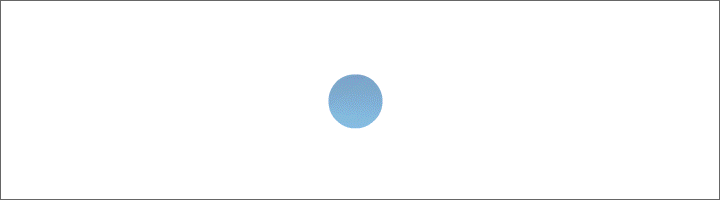Familienausflug
Von Felix Feigenwinter
Herr und Frau Busenhart unternehmen einen Sonntagsausflug mit ihrer einzigen Tochter Monika, die seit dem Tod ihres Kindes aus der elterlichen Wohnung ausgezogen ist. Die kleine Familie wandert nach einer stummen Kletterei über einen steilen Waldweg an weidenden Kühen vorbei über eine ungewöhnlich weite, von Sonnenlicht überflutete Hochebene, über die ein kühler Wind weht. Während einer Rast in einem Bergrestaurant entnimmt Monika ein gelbes Päcklein ihrer Ledertasche, die sie von der Mutter zu Weihnachten geschenkt bekam, und zieht daraus eine Zigarette, die sie sich zwischen die Lippen klemmt. „Muss das sein“ tadelt der sonst schweigsame Vater, „nur infantile Leute stecken sich Sargnägel in den Mund!“ – „Wisst ihr eigentlich, wie alt ich bin?“ schreit nun die Tochter. - „Zu alt, um pubertär zu reagieren“, antwortet der Vater trocken.
Auf der Heimfahrt, in einem von rucksacktragenden Wanderern überfüllten Eisenbahnwagen, erlebt die Tochter, wie der Vater einen kleinen kläffenden Hund zurechtweist, den er, mit schriller Stimme, als „unerzogen“ beschimpft. Die Dame, die das Tier an einer Leine hält, fragt er, ob sie einen Waffenschein besitze. Die Hundebesitzerin zeigt sich gekränkt; offenbar erteilt sie dem Tier nun heimlich den Befehl, in des Vaters rechte rote Wollsocke zu beißen, was diesen veranlasst, mit seinem Spazierstock gegen den Hund zu sticheln. Die Dame bezeichnet Herrn Busenhart als „ordinären Menschen“, und einige der übrigen Fahrgäste beginnen zu tuscheln.
In der Halle des Hauptbahnhofs, in den der Zug einfährt, erheben sich die Ankömmlinge mit steifen Blicken. In Einerkolonne verlassen sie den Eisenbahnwagen, in einen Menschenstrom eintauchend, der sich anarchisch durch die Bahnhofskanäle wälzt. Draußen sondert sich Monika fast wortlos von ihren Eltern ab und eilt zu ihrer Zweizimmerwohnung. Sie wird, wie oft um diese Zeit, von Störchen überholt, die entlang der Strasse wenige Meter über der elektrischen Tramleitung dem zoologischen Garten zustreben. Vor dem Haus bleibt Monika stehen und sieht einen Schwarm Krähen, der nordwärts zieht. Sie wartet und stellt sich vor, einer der schwarzen Vögel würde zu ihr herunterstürzen, um ihr eine Botschaft ins Ohr zu krächzen. Es geschieht aber nichts dergleichen; der Schwarm flattert hoch über den Dächern den Bergen zu. Endlich in der Wohnung angekommen, zieht sich Monika sogleich ins Schlafzimmer zurück, wo sie sich schnell entkleidet und erschöpft aufs Bett fällt. Das kräftige spitze Messer kommt ihr in den Sinn, das noch im ersten Besteckfach in der obersten Küchenschublade liegt. Es wäre an der Zeit, es verschwinden zu lassen; vielleicht wirft sie es morgen auf dem Weg ins Büro in den Fluss.
Sie steht an einem Dachfenster und sieht in einen Garten. Es ist Abend. Die alte Frau, die im Garten an einem Tisch sitzt, droht in der Dämmerung zu versinken. In der Ferne geistern zwischen Baumgerippen Lichtkolonnen. Die alte Frau erhebt sich, reckt den Kopf und verharrt lauschend. Auf einmal beleuchtet grelles Scheinwerferlicht den Kiesweg, die Grasmatte schimmert; Monika hört im Traum Kies knirschen. Die alte Frau zeigt mit ausgestrecktem Arm gegen den in den Garten rollenden Wagen. Auf dessen Kühlerhaube liegt ein blutverschmiertes Kind, ein schwerverletztes oder totes Mädchen, das wie eine Trophäe in den Garten geschoben wird. Monika schreit – und erwacht.
Während Wochen schlitzte Monika mit dem Messer, das sie in einem Warenhaus günstig erworben hatte, die Pneus parkierter Autos auf. Ihre triebhaften, scheinheiligen Abendspaziergänge entlang verschiedener Parkplätze hatte sie ihrem Psychiater anvertraut, und dieser warnte sie: „Damit zerstören sie sich selbst!“ Die Zeitungen berichteten von „Vandalenakten“; in Leserbriefen schworen aufgebrachte Autobesitzer Rache. Aber niemand konnte das Pneustechen verhindern, geschweige denn Monika als Täterin entlarven. Die Eltern verhalten sich ahnungslos.
Inzwischen ist sie zur Ruhe gekommen. Sie hat die Zerstörung des Kindes gerächt. Traum und Wirklichkeit zerflossen. Nur ihr Psychiater weiß Bescheid; im Schutz seines Arztgeheimnisses wähnt sie sich geborgen.
Diese Geschichte erschien 1997 im "Beobachter".