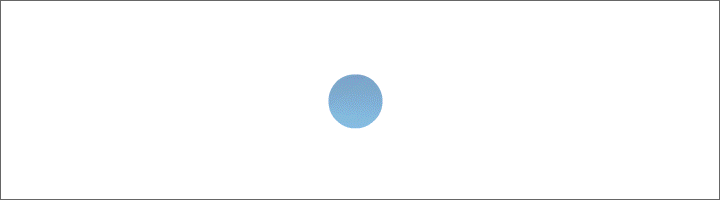Zwei Jahre nach der Aufführung des provokanten vatikankritischen Bühnenstücks „Der Stellvertreter“ am Basler Stadttheater im Herbst 1963, das auch in der Stadt am Rheinknie Widerstand, hitzige Debatten und eine Strassendemonstration auslöste, besuchte der „doppelstab“-Journalist Felix Feigenwinter den umstrittenen deutschen Bühnenautor Rolf Hochhuth in seinem Schweizer Domizil in Riehen bei Basel.
Begegnung mit Rolf Hochhuth
Von Felix Feigenwinter
Unlängst sah ich einen Mann, der offensichtlich entweder Rolf Hochhuth oder dessen Doppelgänger war, auf dem Velo durch den Petersgraben radeln. Ich hatte gehört, dass der weltbekannte Autor des Bühnenstücks „Der Stellvertreter“ in der Wohnung des Buchhändlers Max Bider im „Seidenhof“ am Blumenrain 34 lebe. Ich setzte mich daher mit diesem in Verbindung und erfuhr nun, dass dies zwar während mehrerer Monate der Fall gewesen, doch Hochhuth inzwischen mit seiner Familie nach Riehen gezogen sei.
Weil aber im neuen Heim noch kein Telefon eingerichtet ist, konnte ich ein Interview nicht sofort arrangieren. Eine schriftliche Kontaktaufnahme erwies sich infolge des enormen Andrangs im Briefkasten ebenfalls als ungeeignet. So redete ich den prominenten, am 1. April 1966 fünfunddreissig Jahre alt werdenden Hessener zwangsläufig im „Bischofshof“ an, wohin ihn Münsterpfarrer Fritz Buri kürzlich zu einem Diskussionsabend gerufen hatte. Hochhuth bat mich, ihn in Riehen zu besuchen.
So liess ich mich an einem Samstagnachmittag in der mit norddeutschen Barockmöbeln ausgestatteten Vierzimmerwohnung von Marianna, der lebhaften blonden Gattin des Schriftstellers, mit Tee und Gebäck verwöhnen. Rolf Hochhuth war eben damit beschäftigt, eine grosse Photographie Churchills an die Wand zu heften: „Der hat auch uns Deutsche von Hitler befreit“. An einer anderen Wand hängt ein hölzerner Hampelmann mit einer Schnur zum Ziehen zwischen den stämmigen nackten Waden, eine Holzpuppe mit bayrischen Lederhosen, unverkennbar eine Karikatur von Franz Josef Strauss. Dazu Hochhuth: „Ein Architekt aus München hat mir den Hampelmann geschenkt, nachdem mich Strauss in der 'Bild'-Zeitung und im Bundestag angegriffen hatte.“
Im Kanton Zug wurde ihm die Niederlassung verweigert
Nach diesem Abstecher in die grosse Politik frage ich Rolf Hochhuth nach den Gründen seines Verweilens in der Schweiz. Vorerst erinnert er daran, dass er im Herbst 1963 von seinem damaligen Wohnort Gütersloh in Westfalen nach Basel gekommen war, um den Text für die Inszenierung des „Stellvertreters“ im Stadttheater zu bearbeiten. Zuerst wohnte er im Hotel, nachher mitsamt seiner Familie beim Buchhändler Bider. Nachdem ihm dann im Kanton Zug, wo er für einen deutschen Verlag hätte arbeiten sollen, die Niederlassungsbewilligung verweigert worden war, stellte er sich dem Basler Stadttheater als Regieassistent zur Verfügung. Warum er diese Tätigkeit sehr bald wieder aufgab? Hochhuth nennt zwei Gründe:
Erstens wurde Theaterdirektor Schramm wegen der - übrigens kostenlosen – Beschäftigung des „Stellvertreter“-Autors von verschiedenen Seiten angefeindet und unter Druck gesetzt, und zweitens erfuhr Hochhuth, dass sich einheimische Studenten für ein Volontariat interessierten - „ich wollte keinem Schweizer den Job wegnehmen“.
Erstaunen mag, dass nun der frühere Buchhändler und heutige weltbekannte Dramatiker Basel trotzdem nicht den Rücken zukehrte. Hochhuths Begründung: „Das Basler Stadttheater war die erste Bühne im deutschen Sprachgebiet, die den 'Stellvertreter' nach der Uraufführung in Berlin zeigte... Es hat mich aber auch beeindruckt, mit welcher spontanen Herzlichkeit mir viele Basler beigestanden waren, als die Demonstrationen gegen den 'Stellvertreter' anliefen.“
"Kritischer und spöttischer Menschenschlag“
Anderseits bekennt Hochhuth, dass ihm die Art, wie in Basel gegen den „Stellvertreter“ opponiert worden ist, gefallen hat. „Es wäre sinnlos, Dinge zu schreiben, die nicht in Frage gestellt würden.“ Den Basler bezeichnet er als „einen kritischen und spöttischen Menschenschlag einer sehr selbstbewussten, alten, freien Stadt“. Basel gefällt ihm besser als Zürich, „weil es mehr Atmosphäre hat. Hier spürt man allerorts den Geist der Universität.“
Auch die mittelalterlichen Gebäude, die Museen, die Bibliotheken und die Universität, wo sich Hochhuth als Gasthörer weiterbildet, haben es ihm angetan. „Wenn mich Freunde aus dem Ausland besuchen, quartiere ich sie immer im Hotel Krafft ein, damit sie das Münster und den Rhein sehen.“
Als einzigartiges und phänomenales Ereignis bezeichnet er sodann die Basler Fasnacht. „Vor zwei Jahren war ich in New York, aber meine Frau schilderte mir den Ablauf der Fasnacht brieflich. Dieses Jahr stand ich dann während des 'Morgestraichs' auf der Terrasse des 'Baslerstabs' und ass danach fast wie ein richtiger Basler Mehlsuppe. Sie ist ein wirklich unvergleichliches Erlebnis, diese Basler Fasnacht – ein Stück Mittelalter.“
Hochhuth freut sich indessen auch an den Möglichkeiten, die ihm die nahe Umgebung als Velofahrer bietet: In der Freizeit radelt er mit seinem fünfjährigen Sohn Martin, der übrigens im Kindergarten schon 'Baseldytsch' gelernt hat, gerne durch die „Langen Erlen“. Der andere Hochhutsche Nachkomme heisst übrigens Friedrich und ist fünf Monate alt; während meines Besuchs schlief er friedlich im Kinderwagen auf dem Balkon.
„Ich lese mit steigerndem Ekel Geschichte“
Die alte Universitätsstadt Basel mit ihren vielseitigen geistigen Anregungen und der schönen Landschaft sei für ihn gegenwärtig der geeignetste Arbeitsort, resümiert Rolf Hochhuth; „hier sehe ich die Bundesrepublik aus der Distanz, ohne isoliert zu sein. Der andere mögliche Arbeitsplatz wäre West-Berlin; doch dort wäre die Ablenkung durch die sehr vielen Kollegen und durch das Theater wahrscheinlich zu gross.“
Gegenwärtig schreibt Hochhuth während fünf bis sechs Stunden am Tag an seinem neuen, zweiten Theaterstück über das Problem des Luftangriffs auf offene Städte; das Werk (Arbeitstitel: „Soldaten“) soll voraussichtlich im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Hochhuth betont, dass der von ihm verehrte, kürzlich überraschend verstorbene Walter Muschg viel zur Verwirklichung dieser Arbeit beigetragen habe. Hochhuths übriges Pensum erstreckt sich auf das Lesen vor allem geschichtlicher Bücher („ich lese mit steigerndem Ekel Geschichte“) sowie im Beantworten der immer noch im Zusammenhang mit dem „Stellvertreter“ eintreffenden vielen Briefe.
Solche Post hat Hochhuth in Gewissenskonflikte gebracht:
"Früher verachtete ich Schriftsteller, die Zuschriften von Lesern nicht beantworteten. Heute bin ich selber in dieser Situation. Bisher erhielt ich etwa 15'000 Briefe. Obwohl ich eine Sekretärin beschäftige, ist es mir nicht möglich, die meisten zu beantworten. Viele sind persönlich und erfordern zur Erwiderung besondere Nachforschungen in Archiven.“
Nach weiteren Zukunftsplänen gefragt, verrät mir Hochhuth, dass sein drittes Bühnenstück vermutlich eine Komödie ist. „Die deutsche Literatur der Gegenwart bringt wenig Humor auf, aber Hofmannsthal hat doch gefordert: Nach verlorenen Kriegen muss man Lustspiele schreiben. - Ich lach' auch lieber, als dass ich traurig bin.“
Zum Abschluss unserer fast drei Stunden dauernden Plauderei schenkt mir der Dramatiker ein Exemplar seiner bisher einzigen, nur als Privatdruck im Rowohlt-Verlag erschienenen Novelle „Antigone“.